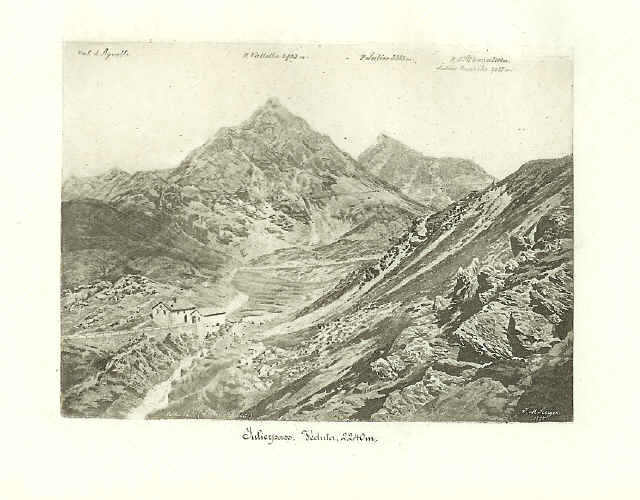|
Der Wonnemonat meint es in diesem Jahre ganz besonders gut. Er hat uns in den Tagen bisher mit dem herrlichsten Sonnenschein und balsamischer Luft begrüßt. In der Stadt ist die ganze Natur schon ungewöhnlich weit entwickelt; die Obstbäume haben fast alle schon die Blüten geschneit und die so unvergleichlich schönen Wallanlagen sind in saftiges Grün gekleidet. Wenn ich mit Wilhelm oder Martin hindurchgehe, wie ich fast täglich tue, freue ich mich jedes Mal, dass ich das Frühjahr hier noch einmal durchleben kann.
Auf der Weser vor unserem Hause ist es auch schon Wochen lang recht lebendig. Eine Unzahl kleiner Segel- und Ruderboote spielt um die größeren Frachtschiffe, welche in ernsterer Arbeit als jene Schmetterlinge auf- und abfahren. Jenseits des Stromes winkt die große Weide, eine Lust für Kühe und Menschen. Sie ist ganz mit gelben und weißen Blumen besät, die dem grünen Teppich einen duftigen Schleier übergeworfen haben. Ich war im Laufe der Woche mit Wilhelm zu einer botanischen Exkursion drüben. Heute sind die zahlreichen Kuhherden zum ersten Male ins Freie gelassen, um ihren Futterplatz nun bis zum Spätherbste nie wieder zu verlassen. Sie gebärden sich heute mit Brüllen und Springen noch etwas ungebärdig. Binnen weniger Tagen aber werden sich diese Erstlingsgefühle gelegt haben, und dann kann man ungefährdet durch sie hindurchgehen. Ich habe in den letzten Tagen einige neue Bekanntschaften angeknüpft.
Seit acht Tagen verkehre ich einmal in der Woche, gestern zum zweiten Male, in dem christlichen Vereine junger Kaufleute, der sein Versammlungslokal im Stephanie-Gemeindehause hat. Es sind meist recht nette Leute aus besseren Ständen, die diesem Vereine angehören. Wenn auch nicht Alles dabei nach meiner Meinung musterhaft ist, so habe ich doch hier sicher Gelegenheit gute Erfahrungen auf dem Gebiete des Vereinswesens zu sammeln. Die Gesellschaft hat einen geselligen und einen religiösen Zweck. Alle acht Tage findet am Donnerstag eine Sitzung statt. Gesellige Unterhaltung und Bibelbeschäftigung wechseln dabei ab. Alle Leistungen sollen von Vereinsmitgliedern geschehen. So wurden an dem einen Abende, den ich dort zubrachte, kleine Aufsätze verlesen, die sich über irgend welche Tagesfragen, merkantile oder in anderer Weise interessante Gegenstände verbreiteten. Nach Verlesung eines Abschnitts wird einer Debatte Raum gegeben, bei welcher man sich das letzte mal recht lebhaft beteiligte. Um nicht ganz auf ideale Genüsse beschränkt zu sein, wurde auf Vereinsunkosten Tee getrunken; auch Zigaretten zu rauchen ist gestattet.
Äußerlich in derselben Weise verlief der Bibelabend, welchen Pastor
Leipoldt gewöhnlich leitet. Gestern hatte er sogar das Referat. Dasselbe war sehr gut und tiefgehend. Es beschränkte sich den ganzen Abend über auf drei Verse aus der Schöpfungsgeschichte. Hier war aber die Beteiligung an der Debatte recht mangelhaft. Außer
Leipoldt, Cand. Schöl und mir sprach nur noch ein Herr Hasencemp, welcher im Verein sehr zu dominieren schien, und, wie ich nachher hörte, durch seine etwas rigoros ausgesprochenen Ansichten die jungen Mitglieder oft einschüchtert. Wie
andere, eigentliche Vereinsmitglieder der Aufgabe des Referats gerecht werden, da sie von theologischer Behandlung Nichts verstehen, bleibt abzuwarten. Ich hatte gestern Abend Martin veranlasst, mit mir in den Verein zu gehen, und hoffe, dass er sich dauernd dafür interessieren lässt. Es wäre gut, wenn er dadurch hier einen festen Halt bekäme.

Franz Michael Zahn
Heute, Sonntag, Mittag war ich bei Missionsinspektor
Zahn zu Tische geladen, wo ich einige recht angenehme Stunden zugebracht habe. Die Veranlassung, die mich dorthin führte, war eine sehr plötzliche. Ich hatte bisher zwar schon verschiedene Male versucht,
Zahn näher zu treten, ich hatte aber auf seiner Seite wiederholt viel Zurückhaltung gefunden. Seine Frau sah ich wohl zu den
Vietorschen Familienabenden, aber wie viele Andere dort nur von Weitem. Am letzten Male saß ich bei Tische neben ihr, und fand da mehr als eine gewisse Bigotterie und zurückhaltende Empfindsamkeit, die ich nach dem oberflächlichen Eindruck bei ihr vorausgesetzt hatte. Sie zeigte sich als sehr belesen und besonders
kunstsinnig, sodass ich seit langer Zeit keine so angenehme Unterhaltung gehabt hatte, als an jenem Abende. Ich versprach ihr bei dieser Gelegenheit ihr Winkelmanns "Geschichte der Kunst" zu bringen, was ich einstweilen getan habe; ich erhielt von ihr nach Verabredung "Michelangelo" von Grimm zugeschickt, da ich sie nicht zu Hause traf. Zugleich schickte sie mir eine Einladung für heute, die ich um so lieber annahm, als ich dadurch auch ihrem Manne näher zu kommen Hoffnung hatte.
Nachträglich freue ich mich noch gerade heute nicht zu Hause gesessen zu haben. Doktor Reuss, der spezielle Arzt von Frau Albers, für den ich nicht besondere Zuneigung habe, hat heute hier im Hause gegessen. Bei Zahns kam ich im Domicilium der Familie in ein wahres Kunstmuseum, was ausnahmslos das Werk der Frau zu sein scheint, da
Zahn wenig Interesse daran zu nehmen schien. Wohin ich blickte, traf das Auge Bilder und Statuetten, die durch das Grün von wohlgepflegten Pflanzen in ihrer Wirkung noch gehoben wurden. Die einzelnen Sachen waren meist Perlen in ihrer Art: gute Photographien nach Raphael, auch eine Polychromie von Fresken. Seit langer Zeit sah ich auch wieder den ersten Claude Lorrain. Kaum hätte ich erwartet, dass die religiös-ernste Schottin, das ist Frau Zahn, in der Auswahl der Kunstwerke soviel freie Nachsicht haben würde den Hermes von Praxiteles aufzustellen. Ich freue mich über ihre weit herzige Auffassung und hoffe noch öfter mit ihr in Berührung zu kommen. Ob ich zum Inspektor
Zahn noch in ein näheres Verhältnis treten kann, ist mir fast zweifelhaft. Fast scheint es mir, als ob ich ihm nicht sympathisch wäre.

Alles was mich umgibt und augenblicklich beschäftigt, weist auf die Zukunft. Nur eine Predigt, die ich vorgestern, am Himmelfahrtstage, in Hastedt hielt, und ein Referat über das schwierige vierte Kapitel des Eph. Briefs, welches ich nächsten Montag in der Pastoral-Konferenz halten muss, zieht mich für einige Zeit in gegenwärtige Fragen. In anderer Beziehung bin ich voller neuen Pläne. Gestern Abend befragte ich Frau Konsul Albers, wie es um meinen eventuellen Nachfolger steht. Mit Herrn Konsul, der augenblicklich für einige Wochen in Marienbad weilt, hatte ich mich in den letzten, unruhigen Tagen nicht besprechen können. Da erfuhr ich nun, dass man mich hier bis zum Herbste halten will. Und ich, wie wetterwendisch, bin ganz zufrieden damit. Ich befinde mich jetzt hier recht wohl, und habe die gute Hoffnung, dass diese Stimmung in dem noch übrigen halben Jahre so bleiben wird. Gott gebe es.
Es ist auch bereits entschieden, dass wir während der heißen Wochen des Sommers wieder nach Sils gehen. Von dort zurückgekehrt, wohnen wir in den noch verbleibenden schönen Tagen auf dem Lande, in Lehmkuhlenbusch. Das Landhaus ist, soviel ich bis jetzt davon gesehen und gehört habe, sehr freundlich und einladend. Dass unter solchen Umständen mein alter Plan aufgegeben werden muss, im Herbst das Examen in Dresden zu absolvieren, versteht sich von selbst. Es wird aus der Sommerarbeit überhaupt nicht viel werden; wenigstens in Theologie. Ich will deshalb die Zeit, welche ich noch in der hiesigen Stellung vorbringe, nach meiner Meinung recht praktisch für die Zukunft anlegen.
Ich will Englisch lernen. Dazu werde ich auch in Sils Zeit und Gelegenheit finden. Hoffentlich komme ich wenigstens so weit, dass ich Bücher lesen lerne. Dass ich es bisher noch nicht konnte, hat mir schon manche Ungelegenheit gebracht. Besonders für das Studium der Missionsgeschichte, der ich mich in letzter Zeit mehr als bisher zugewandt habe, hoffe ich bemerkenswerten Nutzen. Heute habe ich schon nach einem Lehrer gesucht; im Laufe der nächsten Woche soll der Unterricht beginnen, natürlich in etwas forcierter Eile. Eine kurze Unterbrechung wird nur noch Pfingsten bringen, wo ich, will's Gott, mit dem lieben Bruder Fürchtegott nach Helgoland fahren will. Ich freue mich seinet- und meinetwegen darauf. Vielleicht fährt auch Martin als der Dritte im Bruderkleeblatt mit uns.

Das tägliche Einerlei wurde einmal angenehm unterbrochen. Die vergangenen Pfingsttage haben mir recht wohl getan; nur dem Magen nicht. Die erste Festfreude war Fürchtegotts Besuch. Der gute Förster hat einmal seinen Horizont erweitert. Er ist zum ersten Male auf Reisen gegangen. Dass er es zuweilen etwas unpraktisch treibt, ist selbstverständlich. Jedenfalls hatte er viel Freude daran einmal aus seinem engen Verhältnisse heraus zukommen, uns in unserm Lebenskreise und mancherlei neue Dinge und Menschen zu sehen. Der Eindruck, den diese neue Welt auf ihn machte, war sichtlich ein guter; doch bin ich überzeugt, dass er, in seine Arbeit zurückgekommen, sich nicht nach einem anderen Leben sehnen wird. Er ist so glücklich sich in seiner Stellung und in den darin gegebenen Verhältnissen wohl zu fühlen. Er ist um diese Zufriedenheit mit Wenigem wahrlich zu beneiden. Für die Reise hierher hatte er wacker gespart; darum konnte er sie auch recht gemächlich genießen. Er ist heute noch nach Hamburg gefahren, um von dort aus Kiel zu besuchen und dann über Berlin nach Lorenzkirchen zu reisen. Was er dort wird Alles zu erzählen haben und wissen, das mag wohl nur mit den Künsten einer Dido die Kuhhaut zu fassen. Die brüderliche Reiselust hatte auch Martin und mich erfasst.
Wir hatten schon
seit länger mit Fürchtegott nach
Helgoland zu fahren beschlossen, und haben diesen
Plan während der Pfingsttage auch zur Ausführung gebracht. Wir wurden von
herrlichsten Wetter begünstigt, und dazu fehlte es nicht an angenehmer Gesellschaft. Eine Anzahl Mitglieder des Vereins
Christlicher Kaufleute machten dieselbe
Tour,
wie wir; unter ihnen auch der liebe Ringwaldt, dessen Verkehr mir, so oft ich
ihn sehe, immer angenehmer wird. Ich habe ihn zuerst bei Vietors kennen
gelernt, wo er sehr viel in der Familie verkehrt, und seiner liebenswürdigen
Bescheidenheit und seines vielseitigen Interesses wegen stets gern gesehen ist.
Eine neue Bekanntschaft machten wir noch auf dem Schiff. Es fuhr mit uns
ein junger Schwede, Frick mit Namen, der ebenso angenehm in seinem Verkehr war, wie einnehmend im
Äußeren. Ich habe mir von ihm Mancherlei über
Schweden, das
Land meiner Zuneigung erzählen lassen. Zu solcher eingehender Unterhaltung bot
die gemeinschaftliche Reise viel Gelegenheit, denn die Fahrt in Eisenbahnwagen
und
Dampfschiff dauerte trotz des besten Wetters acht Stunden. Wir fuhren am ersten
Pfingsttag zeitig hier ab. Die Bahnfahrt dauerte für unsere hochgespannten Erwartungen
fast zu lange. Sollten wir doch heute zum ersten Male das Meer sehen. Wir ahnten
noch nicht, das wir seinen Anblick nur so langsam mit stetiger Erweiterung des
Horizontes haben würden. Bremerhaven liegt noch völlig an der Weser, die
freilich
eine recht stattliche Breite von etwa ¾ Stunden hat, aber doch Nichts von der
herrlichen, durchsichtig grünen Farbe des Meeres zeigt.
Der Hafen beschäftigte
uns
für diesmal nicht; er kann auch den Vergleich mit Hamburg bei weitem nicht
aushalten.
Bei unserer Ankunft stand das Schiff schon bereit, welches uns an das Ziel
unserer
Wünsche bringen sollte. Es war ein kleiner, aber kräftig gebauter Dampfer. An
Länge und Breite mochte er einen gewöhnlichen Flussdampfer nicht um vieles
übertreffen, aber die Brüstungen, die mir fast zur Achsel reichten, die großen
Anker und schweren Ketten zeigten, dass das Schiff einer schweren Arbeit
gewachsen
war, als das sanfte Gleiten des Weserstromes zu brechen. Kurz vor uns
fuhr ein zweiter Dampfer nach Helgoland ab, der wegen des wohlfeilen
Preises außerordentlich überfüllt war. Wir freuten uns auf dem Verdeck
wenigstens noch so viel Spielraum zu finden, dass wir zuweilen auf-
und abgehen konnten. Bei der Ausfahrt, wo die Umgebung noch nichts
von Bedeutung bietet, waren wir so glücklich, viele auslaufende Schiffe
zu beobachten. Unter ihnen war ein großer Lloyd-Steamer, der
"Main", welcher an demselben Tage nach New-York auslief.
Er war sehr gut besetzt; das Zwischendeck voller Auswanderer, die den letzten so schönen Tag in der Heimat gewiss mit besonderer Wehmut feierten.
Nach und nach überholten wir durch jugendliche Kraft unseres
Fahrzeugs die meisten der Segler vor uns. Ich wurde dabei von der ersten Augentäuschung auf See überrascht. Anfangs scheinen die Schiffe im Fahrwasser
vor uns einer kleinen Flotte gleich unmittelbar neben und hinter einander
zu fahren. Beim Näherkommen aber sahen wir, wie sie viele Kilometer
weit auseinander fuhren. Nach ¾-stündiger Fahrt passierten wir die Forts,
welche zum Schutze des Hafens angelegt sind und nach sachverständiger
Versicherung Bremerhafen absolut sichern sollen. Sie gleichen kleinen
grünen Inseln. Auf ihnen erheben sich flache Türme, an deren
einen wir Kanonen großen Kalibers hervorschauen sahen.
Allmählich
traten die Ufer des Heimatlandes weiter zurück, nur ein Baum
oder Haus ragte zuweilen noch am Horizont hervor, und verriet
uns das Dasein des Festlandes. Noch war der Leuchtturm zu passieren, und dann
hatte das Auge keinen festen Ruhepunkt mehr, wohin es auch schweifte. Wir blickten wenig auf das Treiben neben uns und
hinter uns. Der neue Anblick des Meeres nahm uns ganz gefangen. Da
lag die weite, blaue Nordsee, fast glatt wie eine Fläche von Glas. Nur
das Schiff zog Furchen und bewegte für einige Augenblicke den Spiegel.
Wir schauten jetzt bei der lebhaften Umgebung schon träumerisch in die Ferne,
wie viel mehr mag dieser Blick ins Weite zu sinnvoller Beschaulichkeit reizen, wo man in Einsamkeit der lästigen Störung fern
ist. Doch auch das Meer vor uns blieb heute nicht lange ruhig und
leer. Bald tauchten in der Ferne Segelschiffe auf, die mit ihren Windesfittigen an uns vorüber zogen. Sie kamen ganz in unsere Nähe,
so dass wir die großen Dreimaster in aller Ruhe von oben bis untern
ansehen konnten. Wie viel schöner ist doch so ein altmodisches Segelschiff als
die modernen Rauchkästen! Wie stolz schwellen die Segel, wie viel
mächtiger erscheint durch die drei Masten und das Tauwerk der ganze Bau;
und wie viel phantastischer ist die Form dieses Riesenschwanes! Wir konnten uns kaum satt sehen an dem herrlichen Schauspiele und hätten darüber
fast ganz die Insel vergessen, die jetzt schon in dämmerndem Grau
am nördlichen Horizonte erschien.
Nun waren wir nach der Aussage
der Seeleute erst auf der Nordsee; den Weg bisher nannten sie noch
Weser. Gleichsam um ihre Meinung zu bekräftigen, veränderte das
Wasser auch ein wenig seine Oberfläche. Nicht dass die weißen Kämme
oder "Gänse", wie die Schweden sagen, erschienen wären. Dazu war die
Luft nicht genug bewegt. Aber die Oberfläche zeigte ein weiches Wogen und
Fliessen, wie es offenbar nur dem Meere eigentümlich ist. Ich sah zwei
Bewegungen; eine die gewissermaßen im Wasser selbst lag und eine andere
geringere, welche der leichte Lufthauch hervorrief. Unter so günstigen Umständen kamen wir ohne den gefürchteten Feind der Seefahrten dem Roten
Eilande näher. Helgoland ist, sollte ich meinen, das Ideal von einer
Insel. Es besteht aus einem niedrigen Teile, dem so genannten Unterlande, welches
sich nur wenig über dem Wasserspiegel erhebt, und dem größeren Oberlande.
Der untere Teil besteht offenbar aus angeschwemmten Sand und Geröll, sowie
aus verwitterten Teilen des roten Felsens, der die Grundlage der ganzen
Insel bildet. Seine obere fast ebene Fläche ist ebenfalls stark verwittert,
und macht fast überall den Anbau von Grass, Kartoffeln und magerem
Getreide möglich. So hat das Wort von der Insel entstehen können: Weiß
ist der Strand, rot ist die Kant, grün ist das Land – Das sind die
Farben von Helgoland. Schon vom Schiff aus sahen wir die Stadt, oder wie man
sonst die einzigartige Sammlung der kleinen Wohnhäuser auf der Insel nennen will. Sie liegt teils am Strande, zum
größeren Teile auf
dem Felsen.

Ein kleines Boot erschien bald an der Seite unseres Dampfers,
und führte uns zur Landungsbrücke. Hier stand der englische Gouverneur
der Insel, und begrüßte die Schiffe im Vollgefühl seiner Würde. Unser
nächster Gang war hinauf ins Oberland, wo wir uns in "The Queen of England"
eine zwar bescheidene, aber zweckentsprechende Wohnung sicherten. Ich hatte Aussicht auf die See, und der Leuchtturm Einsicht in
mein Schlafzimmer. Uns waren fast 24 Stunden zur Belustigung auf der
Insel gegeben; da wir sie mit einigen Tausend Pfingstbesuchern teilen sollten,
so war es nicht anders möglich, als dass wir überall viel Gesellschaft fanden.
Nachdem wir uns leiblich gestärkt hatten,
bestiegen wir wieder
ein Boot, um uns nochmals dem schwankenden Elemente anzuvertrauen. Wir
ruderten ganz um die Insel herum, wobei die grotesken Felsformen
allgemeine Bewunderung erregten. Auch die ausgedehnteste produktive
Anlage, welche Helgoland besitzt, sahen wir bei dieser Gelegenheit. Auf
der Westseite, an unumgänglichen Felsen rüstet nämlich eine Schar
von wilden Enten, "Wummen" genannt. Von ihren weißen Brustfedern
und noch mehr von ihren Guano-Fabrikaten erglänzten weite Flächen
des Felsens. Natürlich ließen wir die Fahrt nicht ohne Gesang vorübergehen, und da wir Alle heiter waren, wurde auch dies mal die Loreley
angestimmt. Nach unserer Rückkehr umkreisten wir die Insel nochmals auf dem Felsen, mit der besonderen Absicht die Sonne ins
Meer sinken zu sehen. Leider hatte der Himmel sich etwas getrübt, sodass von dem Schauspiel fast Nichts zu sehen war. Auch der
Aufgang am nächsten Morgen wurde unsern Blicken dadurch entzogen.

Leider brachte der neue Tag noch eine kleine Enttäuschung. Wir hatten gehofft
auf der Düne baden zu können. Das ist eine kleine Schwesterinsel von Helgoland,
die einen vorzüglichen Badestrand hat. Der Besuch dieses Eilandes war aber an
jenem Morgen so zahlreich, dass wir vor vielen Augen unsere mehr oder
weniger wohlgestalteten Körper hätten preisgeben müssen. Wir verzichteten
also für diesmal, und begnügten uns nur damit, den Blick oft hinüber
schweifen zu lassen. Und das war lohnend. Der helle, fast weiße Strand
kontrastierte in so schöner Weise mit dem dunkeln Blau des Meeres, dass
ich immer von Neuem an die, wie ich jetzt weiß, vorzüglichen Bilder
Achenbachs [?] erinnert wurde, der dieses Farbenspiel bei seinem italienischen
Bildern oft anwendet. Überhaupt war die Mannigfaltigkeit in dem Anblicke
der Wasserfläche ein überraschender. Besonders als die Sonne allmählich stieg,
welche die Wolken durchbrach, und schließlich ganz rein vom Himmel schaute,
da wechselte mit jeder Stunde unsere Augenweide ihren Anblick.
Wir
brachten deshalb fast den ganzen Vormittag im Oberlande zu, und bestiegen
auch den höchsten Teil der Insel, den Leuchtturm. Hier war uns natürlich
die Besichtigung der Leuchtvorrichtung selber interessanter, als ein Rundblick
über
Insel und Meer. Wir fanden jetzt die Erklärung, warum am Abend
vorher das Licht uns so unbedeutend erschienen war. Das Licht ist natürlich
auf die Ferne zu wirken berechnet. Es soll sieben Meilen weit zu sehen sein.
Dies ist erreicht worden, indem man die Strahlen durch sehr fein gearbeitete Glasprismen gehen lässt. Dieselben waren sehr sinnreich rings
um die Laterne angeordnet, um die größtmögliche Leuchtkraft zu erzielen.
Ich war erstaunt, dass der Apparat nur aus einer einzigen Lampe beseht, die mit
einer Art Petroleum gespeist wird. Es brennen in konzentrischen Kreisen sechs Dochte, die jedoch nicht alle in Tätigkeit gesetzt werden müssen. Dies geschieht je nach der Finsternis.
Von diesem Orte des Lichtes gingen wir an einen anderen der Erleuchtung zur Kirche. Sie liegt mitten in dem Gottesacker und fällt doch wenig
unter den andern Häusern in die Augen, weil sie nicht viel größer ist
und vor Allem, weil ihr der Turm fehlt.
Der Gottesdienst war von dem
unseren nicht wesentlich verschieden. Nur insofern entsprach er der
englischen
Sitte, als zwei Geistliche tätig waren; der eine predigte, der andere verrichtete den Altardienst. Sonst wurden wir nur durch die Gebete für die
Königin Victoria etc. daran erinnert, dass es ein Gottesdienst für englische
Untertanen war. Zum Schluss der Feier gingen alle Gemeindeglieder
um den Altar herum, und opferten dabei. Die Reihenfolge hierbei stimmte
merkwürdig mit der beim Abendmahle in der Heimat überein. Den
alten Männern folgten die jungen, und nach ihnen gingen den älteren
Frauen die Mädchen vor.

Nachdem wir so Alles, was die Insel dem Auge bot, gesehen hatten, setzten
wir uns zum letzten Male hier zu Tische, um uns für die Heimreise
zu stärken. Hatten wir aber vorher zuweilen im Stillen die Helgoländer
bedauert, wenn wir die Reihen getrockneter Schellfische hängen sahen, die
hier offenbar für den eigenen Bedarf primitiv vorbereitet werden, so sollten
wir selbst zuletzt noch erkennen, dass Schellfisch doch besser ist als
gar nichts. Es war nämlich in den zwei Tagen unseres Besuchs alles Fleisch
aufgezehrt worden. So blieb uns Nichts übrig als gebratener Schellfisch
und Eier. Als eine Delikatesse habe ich diese Sättigung nicht
angesehen. Wir waren übrigens bester Laune, und machten viele Späße über
die jugendlichen Wallungen des Herzens, die sich bei Einigen, besonders Klepsch nach dem Tanze am Abend vorher eingestellt hatten. Wir
Brüder lernten dieses Vergnügen nur aus den Folgen bei Andern
kennen, an denen sich das Wort erfüllte: arm am Beutel, krank
am Herzen. Die Fahrt zurück war ebenso genussreich, wie die erste
Tour; es gab sogar noch weniger Seekranke als Tags vorher.

Vorgestern war hier das jährliche Missionsfest. Ich habe da einen genussreichen Tag gehabt. Schon vor acht Tagen lernte ich auf dem Vietorschen Familienabend, der jetzt immer im Garten des Kaufmann
Vietor (4. Kaufmannsmühlencamp) abgehalten wird, die zwei Missionare kennen, welche in diesen Tagen ausgeschickt wurden, und morgen per Schiff ihre Reise nach London antreten. Von dort gelangen sie dann über Liverpool gegen Ende Juli an den Ort ihrer Bestimmung. Ich habe die jungen Brüder näher kennen gelernt; sowohl an jenem Abende, wie bald darauf bei einem Spaziergange, den ich mit ihnen nach Horn machte. Ich freue mich, dass dadurch meine Gedanken, mit denen ich bei der Mission bin, nun doch an bestimmten Persönlichkeiten haften. Sicher werde ich von jetzt ab mit mehr Interesse, als bisher die Nachrichten aus Westafrika lesen.
Der erste Eindruck, den ich von den Missionaren empfing, hat mich freilich etwas enttäuscht. Sie schienen mir zu wenig Persönlichkeit zu sein; dazu waren sie noch ziemlich jung. Der eine Hettenkemmner, ein Badenser, war wenig älter, als ich, und der andere, ein Elsasser Kind Goffeney hatte mein Alter noch nicht einmal erreicht. Ich hatte immer gemeint, dass die ausziehenden Missionare große Begeisterung für ihre Arbeit und Verlangen nach dem Orte ihrer Tätigkeit hätten. Auch davon war hier nicht sehr viel zu spüren. Die Armen sahen doch zu sehr ein Todeslos vor Augen, dem sie vielleicht entgegengehen. Aber es fehlte ihnen doch auch nicht an dem Gottvertrauen, das allein ihnen Kraft zu ihrem Werke geben kann.
Auf dem Missionsfest war auch ihre Stimmung eine wesentlich gehobenere, als an jenen Abenden, wo wir recht vertraulich bei einander waren. Die Feier des Tags begann Morgens in der Liebfrauen-Kirche. Diese hatte zu dem Tage ein Festgewand angelegt. Vietors Töchter und ihre Freundinnen hatten Girlanden und Kränze gewunden und die ganze Kirche damit geschmückt. Die Tage der Arbeit, die dies in Anspruch nahm, waren schon Wochen vorher eine Sorge für die guten Mädchen gewesen. Ich kam nach meinen Unterrichtsstunden gerade noch zu rechter Zeit, um die sehr schöne Festpredigt zu hören. An sie schloss sich die Ordination der Brüder an. Vollzogen wurde sie von
Vietor in der herzlichen Weise, die ich bei jeder Gelegenheit an ihm finde. Wie ich nachträglich hörte ist die Formel, welche er ablas, genau dieselbe wie die, welche zur Ordination einheimischer reformierter Geistlicher hier gebraucht wird.
Als diese vorüber war, musste ich leider die Kirche verlassen, da mein englischer Lehrer mich erwartete. Ich verlor dadurch sowohl die Verabschiedung des Fräulein
Laißle, die als die Braut eines afrikanischen Missionars hinausgeht, wie das Abschiedswort des Inspektor
Zahn. Dasselbe muss besonders mächtig und ergreifend gewesen sein. Die Brüder, die mir davon erzählten, waren noch am Nachmittag ganz ergriffen davon. Die erste Nachfeier auf dem Schützenhof fand gegen Abend statt. Es hatten sich mehrere Tausend Menschen dort zusammengefunden. Es wurde viel geredet und gesungen. Außer den beiden Missionaren sprach
Zahn im Allgemeinen über die Bedeutung der Missionsfeste und wiederholte die schon oft ausgesprochene Forderung nach mehr Arbeitern.
Schluttig sprach ein Schlusswort über die letzen Verse der Apokalypse. Dazwischen gab ein Missionar eine interessante Erzählung aus den Zuständen auf dem Missionsfelde. Er war selbst schon fünf Jahre auf der Sklavenküste von Bremen aus gewesen. Augenblicklich weilte er in der Heimat, um sich die verlorene Gesundheit wieder zu holen. Indes hatte er wenig Hoffnung sein Leberleiden gebessert zu sehen.
Nach der Versammlung führte mich der gemeinsame Weg zum Kaufmann
Vietor mit ihm zusammen. Er hat mir dabei Einiges aus dem Leben in der früheren Arbeit erzählt. Welch einen anderen, lebendigeren Eindruck macht so ein gesprochenes Wort, als das, was in den Missionsblättern zu lesen ist. Der Abend wurde mit einer zweiten Nachfeier beschlossen. Bei dieser Gelegenheit lernt ich verstehen, warum Kaufmann
Vietor einen so großen Anbau an seinem Hause hat, in dem wir sonst auch am Abend aßen, das aber selbst die vermehrte Vietorsche Familie nicht füllen konnte. Für diesen Abend waren etwa 60 Personen eingeladen; zum größeren Teile Pastoren aus Bremen und der Umgebung mit ihren Frauen. Indes war auch der Laienstand nicht unbedeutend vertreten, aber natürlich nur durch Leute, die in enger Beziehung zur Mission stehen.
Nach einem längeren Spaziergang in dem herrlichen Garten setzten wir uns an die im Festschmuck wirklich prangende Tafel, wo wir ein einfaches kaltes, aber recht gutes Abendbrot genossen. Ich saß neben einer Verwandten Vietors, Frl. Thusnelda Gess, die mir ihres schönen Namens nicht ganz unwürdig erscheint. Andrerseits hatte ich das Paar Fritz und Helene Vietor zu Nachbarn, die natürlich heute als Gastgeber etwas unruhig waren. Wir haben den genussreichen Abend so lange wie möglich ausgedehnt. Es wurde bei Tische gesprochen und gesungen; beides natürlich im Sinne des Tages. Ich blicke auf diesen Festtag mit großer Freude zurück und hoffe, dass an mir an meinem Teile ein Segen daraus gekommen ist.
Früher meinte ich, dass nur die Brüdergemeinde die Sitte hat den Missionaren Frauen zu senden, welche diese nicht persönlich kennen. Die letzten Tage haben mich belehrt, dass auch in unserer Mission dieser wunderliche Brauch existiert. Das kleine und liebliche Fräulein
Laißle, welche ebenfalls die Reise nach Afrika antrat, kannte ihren Bräutigam noch nicht, der sie auf der Sklavenküste erwartete. Nur einen Brief hatte sie nach den vorhergehenden Abmachungen von ihm erhalten. Ich habe keine rechte Vorstellung davon, wie auf diesem Wege eine glückliche Ehe entstehen soll. Das der Mann mit der Frau zufrieden ist, mag man wohl mit Recht voraussetzen. Ihm steht es nicht frei zu wählen. Das Abgeschlossensein von dem Verkehr mit heimatlichen Frauen muss ihm in einer Jeden eine Perle sehen lassen. Aber wenn man sich in die Stellung einer solchen Braut versetzt, so kann ich mir wohl erklären, was mir die Missionare erzählten. Ein Mädchen, die als Verlobte in die Station kam, fand einst so wenig Gefallen an ihrem Erwählten, dass sie sich weigerte seine Frau zu werden. Bald darauf nahm sie einen anderen Missionar derselben Station. Unter solchen Umständen ist die Heimatfrage eine wirkliche Kalamität, und doch ist es jedenfalls nicht zu tadeln, wenn den ausziehenden Missionaren zur Pflicht gemacht wird im Verlauf der nächsten drei Jahre nicht zu heiraten. Freilich sollten dann Alle die Mahnung ihres Vorstandes befolgen: Brüder, macht die Augen auf und den Mund zu!
Im Zusammenhange mit der Mission wurde mir vor einigen Tagen von Missionar Rosenthal, der
Funckes und mein englischer Lehrer geworden ist, ein Gedanke nahe gelegt, den ich, so schwer es mir auch wird, nicht wohl von der Hand weisen kann. Wie mag es Kaufmann
Vietor bei sich verantworten können, dass er seine Faktorei auf der Sklavenküste unterhält. Seine Leute sollen dort geradezu massenhaft sterben, und doch hält er es nicht für seine Pflicht, die jungen Männer, die er für diese Arbeit annimmt, vorher auf das gefährliche Klima aufmerksam zu machen. Auch soll die Bezahlung in keiner Weise der Gefahr entsprechen, welcher seine Leute entgegengehen. Die Bedingungen aber, durch welche jene Männer auszuhalten gezwungen sind, habe ich aus eigener Anschauung als hart kennen gelernt. Ich kann es nicht korrekt finden, wenn Missionar Rosenthal, wie er mir mitteilte, neulich einen Brief verfasst hat, der jenem das Gewissen schärfen sollte. Es ist mir unerklärlich, dass dies von Seiten seines Bruders bisher noch nicht geschehen sein sollte. Ich denke mir bei Gelegenheit vorsichtig darüber Auskunft zu holen.

Ausflug Visbeker Braut und Bräutigam sowie Opfertisch
 Ein lange gehegter Wunsch ging gestern in Erfüllung. Ich habe
die Hünengräber in der Heide gesehen. Oft schon hörte ich davon erzählen, und
vergeblich bemühte ich mich bisher aus Büchern Aufklärung darüber zu erhalten.
Die hiesige, sonst reichhaltige Bibliothek bot nichts, was die Frage eingehend
erörterte. Die Nachrichten aber, die ich auf Befragen im Kreise der Bekannten
empfing, waren so dürftig und zugleich so nichts sagend, dass sie eher von
weiterem Forschen abhielten, als dazu ermutigten. Erst kürzlich war ich durch
ein Buch von Strackerjan "Land und Leute" von Neuem auf das Interessante der
Hünengräber hingewiesen worden und beschloss darum, den ersten schönen Sonntag
zu einem Ausfluge in die Oldenburgische Heide zu benutzen. Dazu zeigte sich der
gestrige Tag vortrefflich geeignet. Acht Tage lang hatte uns ein trüber Himmel mit
ergiebigem Regen gelabt, und gestern erst sahen wir wieder das Blaue durch leichte
Wolken schimmern, die den Wanderer eher von der Sonnenglut schützten, als durch
drohende Regenschauer schrecken. Ich hatte Bruder
Martin für die Partie gewonnen
und traf mit ihm zeitig am Morgen auf dem Bahnhof zusammen. Wir fuhren
zunächst nach Oldenburg. Diese Stadt birgt zwar in einer Sammlung die Schätze,
welche man in den Hünengräbern gefunden hat, sie vermochten uns indes nicht
länger als wenige Minuten zu fesseln, da sie außer diesen Dingen gar nichts Sehenswertes besitzen soll. Bald führte uns die Bahn in südlicher Richtung von
der Hauptstadt durch das ebene Land. Wir merkten schon an unserer
Reisegesellschaft, dass wir für heute dem gewohnten Treiben der Zivilisation
Lebewohl sagen mussten. Um uns her ward Plattdeutsch gesprochen, ein Idiom, dem
ich noch jetzt nur mit größter Schwierigkeit ein halbes Verständnis
entgegenbringen kann. Ich weiß übrigens nicht und bezweifle es fast, ob der
Eingeborene mein Hochdeutsch besser versteht, als seine Redeweise. So viel
Schwierigkeit auch die Unterhaltung im Bahnwagen machte, so war sie doch
interessanter als der Blick auf die Umgebung des Landes. Kein Berg oder Hügel gibt dem Auge einen Ruhepunkt, wenn es über die weiten, braunen Flächen der
Heide gleitet. Nur selten hebt sich das frische Grün einiger Eichen, welche die
Stelle eines Wohnhauses beschatten, von diesem Einerlei der Farben ab. So kann
man Stunden weit mit der Eisenbahn durch das Land fahren, und nur selten zeigt
ein mageres Getreidefeld, dass der Boden doch nicht notwendig das Land zur
Wüste macht. Ein lange gehegter Wunsch ging gestern in Erfüllung. Ich habe
die Hünengräber in der Heide gesehen. Oft schon hörte ich davon erzählen, und
vergeblich bemühte ich mich bisher aus Büchern Aufklärung darüber zu erhalten.
Die hiesige, sonst reichhaltige Bibliothek bot nichts, was die Frage eingehend
erörterte. Die Nachrichten aber, die ich auf Befragen im Kreise der Bekannten
empfing, waren so dürftig und zugleich so nichts sagend, dass sie eher von
weiterem Forschen abhielten, als dazu ermutigten. Erst kürzlich war ich durch
ein Buch von Strackerjan "Land und Leute" von Neuem auf das Interessante der
Hünengräber hingewiesen worden und beschloss darum, den ersten schönen Sonntag
zu einem Ausfluge in die Oldenburgische Heide zu benutzen. Dazu zeigte sich der
gestrige Tag vortrefflich geeignet. Acht Tage lang hatte uns ein trüber Himmel mit
ergiebigem Regen gelabt, und gestern erst sahen wir wieder das Blaue durch leichte
Wolken schimmern, die den Wanderer eher von der Sonnenglut schützten, als durch
drohende Regenschauer schrecken. Ich hatte Bruder
Martin für die Partie gewonnen
und traf mit ihm zeitig am Morgen auf dem Bahnhof zusammen. Wir fuhren
zunächst nach Oldenburg. Diese Stadt birgt zwar in einer Sammlung die Schätze,
welche man in den Hünengräbern gefunden hat, sie vermochten uns indes nicht
länger als wenige Minuten zu fesseln, da sie außer diesen Dingen gar nichts Sehenswertes besitzen soll. Bald führte uns die Bahn in südlicher Richtung von
der Hauptstadt durch das ebene Land. Wir merkten schon an unserer
Reisegesellschaft, dass wir für heute dem gewohnten Treiben der Zivilisation
Lebewohl sagen mussten. Um uns her ward Plattdeutsch gesprochen, ein Idiom, dem
ich noch jetzt nur mit größter Schwierigkeit ein halbes Verständnis
entgegenbringen kann. Ich weiß übrigens nicht und bezweifle es fast, ob der
Eingeborene mein Hochdeutsch besser versteht, als seine Redeweise. So viel
Schwierigkeit auch die Unterhaltung im Bahnwagen machte, so war sie doch
interessanter als der Blick auf die Umgebung des Landes. Kein Berg oder Hügel gibt dem Auge einen Ruhepunkt, wenn es über die weiten, braunen Flächen der
Heide gleitet. Nur selten hebt sich das frische Grün einiger Eichen, welche die
Stelle eines Wohnhauses beschatten, von diesem Einerlei der Farben ab. So kann
man Stunden weit mit der Eisenbahn durch das Land fahren, und nur selten zeigt
ein mageres Getreidefeld, dass der Boden doch nicht notwendig das Land zur
Wüste macht.
Nach etwa einstündiger Fahrt kamen wir zur Station Ahlhorn, von
wo aus wir unsere Fußtour beginnen wollten. Hier sah es schon besser aus.
Vor Allem starrte uns nicht nach allen Seiten ein offener Horizont entgegen, bei
dem so leicht uns das Gefühl überkommt, dass wir hier von allen anderen Menschen
abgeschlossen sind. Wir konnten es uns vor dem Gasthause "Zur Post" schon ein
Weilchen gefallen lassen. Der helle Morgen brachte uns erquickende Luft
und guten Appetit. Mit unbewusster aber glücklicher Vorsicht verproviantierten
wir unsern Magen für den Vormittag, was uns nachträglich sehr schätzenswert
erscheinen sollte. In der Post hatte man schon mit Freuden von unserer Ankunft
Kenntnis genommen. Der Wagen, welcher mit Postsachen nach der Stadt Wildeshausen
fuhr, sollte nach ihrer Erwartung heute noch einen seltenen Verdienst durch die
Beförderung von Passagieren erzielen. Wir freuten uns aber, dass unsere gesunden
Beine uns auf derselben Strasse zu größerem Genuss führen konnten. Als wir
daher uns an Trank und Speise gelabet, brachen wir auf. Die Stund der Sonne
zeigte uns nach welcher Seite der Strasse, die in schnurgerader Richtung von
Ost nach West führte und viele Kilometer weit nach beiden Seiten zu überblicken
war, wir uns wenden sollten. Wir gingen der Morgensonne entgegen. Die Strasse, welche in recht gutem
Zustande war, dafür aber auch Chaussee genannt wurde und sich als solche
honorieren ließ, durchschnitt schon kurz nach der Station die Heide. Indes,
hier war von ihrer Einsamkeit noch nichts zu spüren. Zu beiden Seiten des Weges
stand eine Reihe schattenspendender Birken, die eine sehr malerische Einfassung
bildeten. Neben ihnen zog sich ein Streifen Nadelholz hin, welcher schmal genug
war, um hier und da einen Durchblick zu gewähren. Wir erblickten da ein weites
Hügelland mit schwachen Wellungen des Bodens. Die braune Heide und die moorigen
Torfstiche verschwammen allmählich in blauer Ferne. Der Duft, welcher weiter hin
über dem Lande lag, schien uns über den wahren Zustand des Landes täuschen zu wollen.
Doch bald änderte sich unsere Umgebung. Getreidefelder schoben sich in die
unfruchtbare Heide hinein und hatten nach wenigen Minuten, die wir weiter
gingen, alles wilde Land zu beiden Seiten der Straße verdrängt. Wir näherten uns
einem Komplex alter Bäume, unter deren Schatten wir bald die malerischen Häuser
eines niedersächsischen Dorfes entdeckten. Welch stattlichen Eindruck macht der
alte Bauernhof unter den Eichen! Wie muss hier das Gefühl von Besitz und
Eigentum wachsen, wo der Bauer in einem Schatten wohnt, den er dem Großvater
verdankt. Hier erscheint das Haus noch als Mittelpunkt von Grund und Boden. Denn
nicht Giebel an Giebel reiht sich hier, sondern Zaun an Zaun. Nach der Zahl der
Gehege könnte man die Größe dieser Dörfer messen.
Nachdem wir das Dorf Ahlhorn verlassen hatten, führte uns die
Straße in derselben Weise, wie vorher, durch die Heide. Wir erfreuten uns an
neuen Blumen und Farnkräutern, die unseren Weg säumten und spürten wenig
von der Einsamkeit, in der wir uns befanden. Erst nach mehrmals einstündiger
Wanderung sahen wir wieder menschliche Wohnungen vor uns, und das war
Steinloge, eine Kolonie des vorhin durchschrittenen Dorfes. Hier leben in Wahrheit
inmitten unseres eigenen Vaterlandes Pioniere der Zivilisation. Diese Menschen
sind in die Heide vorgerückt, um sie urbar zu machen. Dass ihnen dabei das Los
nicht aufs Lieblichste gefallen ist, sollten wir bald aus eigener Anschauung
kennen lernen. Und doch mögen diese Einsiedler, möchte man sagen, in mancher
Hinsicht glücklicher sein, als wir anspruchsvollen und unzufriedenen Kulturmenschen.
Um den weiteren Weg zu erkunden, gingen wir nach dem
nächstliegenden Hause. Weder Zaun noch Tür, noch ein lebendes Wesen wehrte
uns den Zutritt. Vor dem großen Tore zur Diele aber hinderte eine Düngerstätte uns
weiter zu dringen. An der anderen Seite des Hauses aber waren Fenster, durch die
wir ungehindert ins Innere sehen konnten. Wir blickten hinein, und bald darauf
betroffen einander an. Wir sahen - Nichts. Dunkel war's da drinnen, als ob
Jahre lang der Rauch keinen Ausgang gefunden und sich schließlich missmutig an
den Wänden festgesetzt hätte. Wir vermieden es gern, tiefer in die Geheimnisse
der Dunkelheit einzudringen. Da stand der Brunnen nicht weit von dem Hause. Unser
Durst konnte hier gelöscht werden. Aber braun und trübe schien das Wasser in der
Tiefe zu sein. So wussten wir auch hier nicht, was anfangen, zumal der Eimer zum
Schöpfen fehlte. Wir beschlossen zu warten, bis jemand käme, der das Recht auf
diesen Besitz geltend machte. Das Gras unter den Obstbäumen des Gartens lud uns
zum Ruhen ein, und das Singen der Vögel dazu ließ uns für einige Zeit alles
andere vergessen. Unter allerlei Betrachtungen über die primitive Art, in
welcher das Haus und eine kleine Scheuer daneben aus Steinen der Heide und
Holz und Lehm gebaut war, verging eine halbe Stunde, aber niemand erschien, um
uns Eindringlingen die Wege zu weisen. Martin riet zu erneuter Inspizierung, die wir
auf das einzige, noch übrige Fenster ausdehnten. Aber auch diesmal nur ein öder
Raum mit dem dürftigsten Hausgerät. So mussten wir das stille Haus verlassen,
und gingen dem nächsten zu, in dem wir schon von der Ferne Leben erkannten.
Martin meinte, dass die Bewohner uns von weitem bemerkten, und die unerwarteten
und seltenen Fremdlinge in der Türe des Hauses begrüßen würden. Wir kannten
den Stumpfsinn der Leute noch nicht und traten in die Diele ein, ohne das jemand
von uns Notiz genommen hätte. Wie sah es da aus. Rauch verdunkelte den ganzen
Raum, aus dessen Tiefe nur das Herdfeuer uns dunkelrot entgegenleuchtete.
Gleich den Flüchtlingen in alten Zeiten richteten wir unseren Schritt sogleich
auf dieses Heiligtum des Hauses. Hier fand sich auch, was wir suchten. Es
hockten am Feuer zwei Gestalten, die wir allmählich als Mutter und Kind
unterschieden. Man wunderte sich offenbar über unser Eintreten, antwortete aber
freundlich auf unsere Fragen. Dass auch unter den hiesigen Verhältnissen Evas
Töchter an den Eigenschaften ihrer Schwestern aller Orte teilnehmen, ersahen
wir bald aus der vorzeitig an uns gerichteten Frage:

Der mittlerweile hinzugekommene Hausvater kam über ein stumpfsinniges Staunen nicht hinaus, als er
hörte, dass wir aus Bremen gekommen waren, um die Steine anzusehen, von deren
Dasein er übrigens Kenntnis hatte. Der Mann schien mehr als schwerfällig von
Körper und Geist zu sein, über allgemeine, unartikulierte Laute kam er nicht
hinaus. Die bereitwillige Frau ging gern darauf ein, uns außerhalb ihres
verräucherten Domizils zurechtzuweisen. Bei Tageslicht konnten wir sie
wenigstens etwas genauer betrachten, als in dem Rembrandischen Helldunkel
des Hauses möglich war. Schön war sie nicht, und hätte ihre Freundlichkeit uns
nicht auf ein gutes Herz schließen lassen, so hätte sie wohl als Typus einer
Hexe gelten können. Der sehnige, dürre Hals, das durchfurchte Gesicht wurde noch
abschreckender durch das Fehlen eines Auges, welches sie offenbar durch die
rauchige Atmosphäre, in der sie täglich lebte, verloren hatte. Uns konnten
diese flüchtigen Beobachtungen freilich nicht abschrecken, die Alte soviel als
möglich auszufragen. Martin war besser als ich im Stande ihre Sprache zu
verstehen. So wurden wir auf den rechten Weg gewiesen und erhielten dazu noch
Auskunft über das Gehöft, dessen Hausfrieden wir unbedenklich gebrochen hatten.
Herrenlos war Haus und Hof gewesen, denn der Besitzer war nach dem Ausdruck
unserer Pythia "todt gegangen". Da hätten wir freilich lange auf Auskunft warten
können. Zu unserer Freude erfuhren wir noch, dass in der Nähe an der Poststrasse
ein Wirtshaus lag, wo wir einen zwar sehr bescheidenen, aber genügenden Imbiss
einnahmen. Nach dieser Stärkung gingen wir mit neuen Kräften zur "Visbeker
Braut". So hieß das erste der Steinmähler, denen unsere Tour galt. Es lag
keineswegs vereinzelt. Eine kurze Strecke weiter in der Richtung nach
Wildeshausen soll ein noch eben so bedeutendes Steinmonument sein. Andere liegen
noch zu
beiden Seiten der Strasse bis an die Stadt heran, welche selbst für den
Geburtsort Wittekinds gilt.

Wir mussten jetzt die Fahrstrasse verlassen und durch die
Heide wandern, denn die Wege, welche hindurchführen, trugen nur uneigentlich
diesen Namen. Es sind richtiger Wagenspuren. Wir steuerten auf ein kleines
Gehölz hin, das aus Birken und Kiefern und Fichten bestand. Vögel sangen in dem
Heidegebüsch und nichts verriet die Nähe der denkwürdigen Stätte. Da
überschritten wir einen kleinen Erdwall, der zum Schutze um den ehrwürdigen Ort
gezogen war, und mit einem Male trat ein Bild aus längst vergangenen Tagen vor
unser Auge. In zwei langen Reihen waren große Felsblöcke gelegt. An beiden
Enden waren sie durch Querreihen abgeschlossen. Ein heiliger Raum mag es gewesen
sein, der auf diese Weise zu bestimmtem Zwecke abgeschlossen war. Sollten die
Felsblöcke Sitze gewesen sein für eine Versammlung der Männer? Es müssten Riesen
da gehaust haben, denn am westlichen Ende ragten die Steine drei Meter hoch in die
Luft. Auch wollten dazu die Steinhaufen nicht passen, welche mehr nach der
Westseite hin inmitten der Reihen aufgewühlt dalagen. Wie uns der Vergleich mit
den nachfolgenden Monumenten lehrte, rührten sie von einer Grabkammer her, die
einst hier gewesen, jetzt aber von unseren wissbegierigen oder habsüchtigen
Zeitgenossen zerstört war. Sollte der Raum um das Grab etwa eine geweihte Stelle
gewesen sein, die dem Verfolgten eine Zuflucht bot? Oder war das Grab der
Mittelpunkt heiliger Handlungen, wobei die Fürsten und Edlen innerhalb der
Steinreihen treten durften, welche das Volk abhielten? Kein Schriftzeichen, kein
sagenhaftes Wort gibt Kunde davon, und so werden diese Steine noch Jahrhunderte
lang schweigend von der Vergangenheit zeugen. Sie reden freilich auch ihre
Sprache, und wer sie versteht, dem erzählen sie von der Vergänglichkeit des
Menschen und seiner Macht. Denn mächtig waren die Hände, welche dieses Denkmal
schufen. Die Zerstörung aber, die wir angerichtet sahen, ist sie nicht Zeugnis
dafür, wie der Eine mit roher Hand verletzt, was den Anderen heilig und unantastbar war. Für mich lag ein stiller Ernst über diesem Denkmal aus alter
Zeit, und nicht des zerstörten Grabes wegen allein hatte ich den Eindruck auf
einem Friedhofe zu sein. Auf dem höchsten der Steine sitzend schaute ich bald
auf die bemoosten Steine zu meinen Füssen, bald durch die jungen Bäume über die
braune Heide, und es war mir, als müssten soeben über jene Hügel die Scharen
unserer alten Väter herbeiziehen. Doch die Schattenbilder schwanden bald vor
dem warmen Lichte der Mittagssonne, und wir setzten unseren Weg fort zum
Bräutigam der einsamen Braut. Ein Wagengleis zeigte uns die Richtung. Es war ein
weiter und beschwerlicher Marsch durch das Heidekraut, von dem nur eine Art, die
Glocken - Erika schon ihre roten Blüten angelegt hatte. Das braune
Kraut zu unseren Füssen war übrigens nicht so unfruchtbar, wie wir gemeint
hatten. Ein Hirte machte uns auf kleine schwarze Beeren aufmerksam, welche die
Heide trug. Waren sie auch nicht von besonderen Wohlgeschmack, so löschten sie
doch den Durst, der sich allmählich wieder einstellte. Auch an einem angenehmen
Ruhepunkte fehlte es auf unserem Wege nicht. In einer Vertiefung hatte sich
durch die größere Feuchtigkeit ein lebendigerer Pflanzenwuchs entwickelt. Wir
lagen da so weich, wie auf dem kostbarsten Teppiche und schauten eine Zeit lang
auf das Stillleben, das sich in dem grünen Moose abspielte. Aber die Sonne
schritt vor ohne auszuruhen, und sie mahnte uns, dass wir noch einen langen Weg
vor uns hatten. Er führte uns bald zu neuen Sehenswürdigkeiten. Zwei geöffnete
Grabstellen lagen ganz frei in der Heide. Die daneben gehäufte Erde ließ uns
jetzt noch erkennen, dass einst alle die bloßliegenden Steine bedeckt gewesen waren,
sodass das Ganze einem Hügel glich. Es waren hier 8 bis 10 kleinere Blöcke als
Träger in Form eines Rechtecks aufgestellt, welche mehrere große Steinplatten
als Bedeckung des Hohlraumes trugen. Welche Kräfte müssen einst angewandt worden
sein, um die Lasten vieler Zentner zu heben! Sollte sich hier etwa einst
dasselbe abgespielt haben, wie an den Ufern des Nils, wo tausend Hände sich regen
mussten, um für einen König das Grab zu bauen? Es wäre nicht unmöglich, dass wir
auch in unserer Heide die Arbeit der Unfreien vor uns sehen. Wir fanden nur noch
die Trümmer des Werkes, die aber doch hinreichend waren uns einen richtigen
Begriff seiner Vergangenheit zu geben. Menschenhände hatten an einer Schmalseite
die Träger entfernt und den Inhalt herausgewühlt. Man erzählte uns, dass dabei
Urnen zum Vorschein gekommen wären, die sich jetzt in einer Sammlung zu
Oldenburg befinden. Auch Schmuckgegenstände wurden hin und wieder ausgegraben.
Jetzt machen die übrig gebliebenen Steine den Eindruck, als ob gigantische
Hirten sich hier eine feste Zufluchtstätte gegen Wind und Wetter erbaut hätten.
Nicht weit von diesen beiden Grabstellen erblickt man einen
Hain hochstämmiger Föhren. Zwischen ihnen liegt der Bräutigam. Soweit es ohne
Kompass sich feststellen ließ, erkannten wir an ihm dieselbe Richtung von Ost
nach West, wie bei der Braut. Die Übereinstimmung beider sprach sich noch
deutlicher in der Anordnung des mittleren Steindenkmals aus. Auch hier lag mehr
am westlichen Ende der Steinreihen, die hier übrigens etwas länger waren als
dort, eine Grabkammer von ungefähr derselben Dimension, wie jene auf der Heide.
Nachdem wir besser erhaltene Exemplare gesehen hatten, war es leicht, die
Anordnung der jetzt aus einander gewühlten Steine zu
rekonstruieren. Bei der
Übereinstimmung beider Denkmale erscheint ihre Benennung als Braut und
Bräutigam nicht unpassend. Sinnvoll aber war beiden die Umgebung angepasst. Der
Bräutigam liegt im Schatten kräftiger, hochragender Föhren, während das zarte
Grün der Birken wie geschaffen dazu erscheint, die zarte Braut zu decken.

Der Bräutigam war nicht allein in den dunkeln Schatten
gebettet. Ringsum ihn her fanden wir noch eine Anzahl mehr oder weniger gut
erhaltener Denkmäler, von denen eins sogar noch unverletzt war. Die Mächtigkeit
der Steinblöcke hatte noch allen Versuchen der Zerstörung getrotzt. Noch ein
sehenswertes Steinmahl blieb uns übrig, der so genannte Opfertisch. Um zu ihm zu
gelangen, mussten wir ein kleines Gewässer überschreiten, das in dieser Heide
seinen Ursprung hat und von dem größten Hofe in der Umgebung den Namen
Engelmannsbeke trägt. Wir schritten jenseits des klaren Baches eine kleine
Anhöhe hinauf, und standen bald vor dem letzten Ziele unseres heutigen Ausflugs.
Es war ein ganz anderes Bild, als wir sie bisher gehabt hatten. Im Schatten von
fünf alten Eichen lag auf mehreren Trägern eine ungeheuere Steinplatte, größer als
alle vorhergehenden. Einer der Eichbäume wächst aus den Steinen heraus. Er hat
versucht, die harte Fessel zu sprengen, aber vergeblich; er hat sich nur selbst
eine Wunde geschlagen. Einer seiner Brüder ist glücklicher gewesen; er steht
inmitten mehrer Träger, von denen die Deckplatte geschwunden ist. Hat er den
Menschen vorgearbeitet, und ihm den Raub des Baumaterials erleichtert? O, dass
diese Bäume erzählen könnten. Vielleicht wüssten sie zu sagen von jener Zeit, wo
man dieses Mal aufrichtete. Da fiel von den Eichen, in deren Schatten ein
vergessenes Geschlecht seine Feste feierte, eine Frucht in die Erde, welche man
zwischen die Steine häufte. Doch es ist gut, dass sie nicht reden, vielleicht
sind sie erst Kinder der so gesäten Bäume.

Wir waren bei diesem letzten Denkmale wieder den Menschen
nahe gekommen. Rings um den "Opfertisch" wogte der Roggen, und von drüben
hörten wir den Schall menschlicher Stimmen. Durst, der Eingeborene in der Heide,
hatte sich bei uns wieder eingestellt, und den hofften wir wenigstens
stillen
zu können. Ein Wirtshaus
gab es zwar nicht, aber die Bauern waren gastfrei und teilten mit uns gern von
ihren Erträgen. Wir nahmen mit Freuden einen Trunk Milch an. Zwei blonde
Jünglinge, echte Söhne ihrer Heimat, brachten uns Tisch und Stühle in den
Garten, wo wir uns eine halbe Stunde lang erholten. Einer Oase gleich erschien das
Land zu unseren Füssen. Üppig wuchs das Gras zur Seiten des klaren Heidebaches
in der Tiefe, und von drüben grüssten noch ein Lebewohl diese alten Felsblöcke
des "Bräutigams". Die Bäuerin im Sonntagsstaat kam herzu, um uns Gesellschaft zu
leisten, oder vielleicht auch, um ihre Neugier zu befriedigen. Wenngleich die
Unterhaltung in einem Gemisch von Platt- und Hochdeutsch etwas mühsam zu führen
war, so hörten wir doch genug, um unsere Wissbegierde zu befriedigen.
Der Weg, auf dem wir nun den Heimweg antraten, führte eine
Zeit lang durch dieselbe Heide, die wir heute so lange durch schritten hatten,
und brachte uns endlich nach derselben Station Ahlhorn zurück, die wir am Morgen
verließen. Müde zwar, aber in vollstem Masse befriedigt beschlossen wir den Tag.
Ich fürchte es war für lange Zeit die letzte Fußtour, die ich mit Martin
unternehmen konnte. In acht Tagen will ich den Wanderfuß mit der Familie
nach der Schweiz richten.

Soeben bin ich von einem Abendspaziergang durch die Strassen von Chur zurückgekehrt. Es wurde mir fast unheimlich in dem unsicheren Schatten der alten Häuser, und unter dem mancherlei Gesindel, welches die Stadt heute zum Sonntag ganz besonders belebt. So zog ich es vor meine Recogniscierung nicht zu weit auf dem unbekannten Terrain auszudehnen, und suchte bald wieder den heimatlichen "Steinbock" auf, wo wir wohnen. Es wimmelt hier von Fremden verschiedener Nationen. Man kann froh sein, wenn man bei Tische nur ein einziges Ausland in seiner unmittelbaren Nähe vertreten findet. Der Verkehr ist in Folge dessen so ungemütlich, wie nur möglich. Ich hielt es also für das Beste, mich in meine vier Wände zurückzuziehen, die weit genug sind, um als Wohn- und Schlafzimmer zu dienen. Zu letzterem Zwecke stehen mir hier sogar drei Betten zur Verfügung. Indes will ich auch mich schon freuen, wenn ich in einem von ihnen gute Nachtruhe finde. Unter meinen Fenster rauscht ein graues Bergwasser, das dem nahen Rhein zuströmt. Dass die schöne Aussicht, welche sich von hier aus über die Stadt Chur auf die gegenüberliegenden Berge bietet, nicht zur Geltung kommt, bedaure ich, fürchte aber, dass sie morgen früh nicht Reiz genug für mich haben wird, um mich eher aufstehen zu lassen, als nötig ist.
Wir wollen um acht Uhr schon mit Extrapost abfahren, um noch am Abend Sils zu erreichen. Es wird eine sehr stramme Tour von zwölf Stunden sein, wobei vier mal die Pferde gewechselt werden müssen. Ich bedaure diese Eile, da ich gern bei langsamerer Fahrt die Gegend genauer kennen lernen möchte. Doch das liegt nicht in meiner Hand. Bisher ist unsere Reise ganz glücklich gewesen. Das Wetter war zwar nicht immer so schön, dass wir keine Sorge darum gehabt hätten. Indes war bei dem trüben Himmel der Vorteil kühler Temperatur. Wir sind auf demselben Wege hierher gekommen, wie im vorigen Jahre; nur etwas schneller. In Köln konnte ich wieder für einige Stunden den Dom genießen. Je öfter man ihn sieht, um so imposanter und erhebender wirkt der Anblick. Abends und Morgens habe ich ihn gesehen. In der Dämmerung mit Wilhelm, wo wir das Glück hatten, das Geläute der unzähligen Glocken über uns zu hören. Unvergesslich wird mir der Klang sein, der wie Orgelton die hohe Wölbung erfüllte.
Auch diesmal hatten wir einen Tag Pause im Inselhotel in Konstanz. Jeder, der dort gewesen ist, schwärmt für diesen Aufenthalt. Mir wurde er diesmal noch besonders angenehm, da ich des Abends immer gute Gesellschaft fand. Zugleich habe ich Neuigkeiten dort kennen gelernt. Mit den Frauen und Wilhelm fuhr ich gestern Nachmittag nach der Insel Reichenau. Auf dem Dampfschiff Konstanz - Schaffhausen fuhren wir den Rhein abwärts in den unteren See, dessen Ufer weit anmutiger sind, als die, welche an dem oberen Teile bei Konstanz und ihnen gegenüberliegen. Wir hatten vor uns die Höhen des Hegau, dessen Basaltgipfel sich malerisch in dem blauen Hügellande erhoben. An dem mehr denkwürdigen als schönen Schlosse Arenenberg vorbei fuhren wir zu der alten Klosterinsel und durchschritten einen Teil der fruchtbaren Reichenau. Dass sie ihren Namen nicht umsonst trägt, sollten wir bald in dem alten Münster erkennen, dem unser Besuch galt.
Es ist dies eine Kloster-Kirche, deren ältester Teil aus dem 9. Jahrhundert stammt. Das Schiff ist alt, der Chor merkwürdiger Weise im 15. Jahrhundert angebaut. Sonst pflegt es umgekehrt zu sein. Das hohe Alter der übrigens nicht gerade schönen Kirche prägt sich unzweideutig in der ganzen Erscheinung aus. Stil ist in den alten Teilen wenig zu finden. Es sind runde Gewölbe. Die Decke ist platt. Einen ganz wunderlichen Eindruck machen die Fenster. Es sind einfache Ellipsen, die sich sehr der Kreisform nähern. Mehr als diese Äußerlichkeiten nahm unsere Aufmerksamkeit ein Schrank in der Sakristei in Anspruch, wo die Schätze des Klosters bewahrt wurden. Dort lagen wirklich Reichtümer aufgespeichert: Dinge, die nicht bloß für den gläubigen Katholiken wertvoll waren, wie die unzähligen Gebeine der Heiligen, sogar zweier Apostel, die man zu haben meinte. Die Gefäße für diese Reliquien waren aus Silber und Gold, dazu mit kostbaren Steinen besetzt. Dass die Mönche im Besitze solcher Kleinodien Angst und Sorge gehabt haben, sobald Krieg und Raub in Aussicht standen, das ward mir hier begreiflich. Einige der Kästen von edlem Metall waren noch dazu von so hohem Alter (ca. 1.000 Jahre alt), dass sie dadurch schon einen hohen Wert haben. Als Kuriosität war mir auch der Ohrring interessant, den uns der alte Küster zeigte und uns sagte, dass er von der Hochzeit zu Kana stamme. Ich wollte seinen freudigen Glauben nicht verletzen, und wagte darum keinen Zweifel an der Echtheit auszusprechen. Ein anderer seltener Genuss wurde mir heute Morgen noch in Konstanz zu Teil. Ich hatte mich gestern Abend im Refektorium mit Pastor Duntge aus Bremen (Rablinghasen) verabredet, heute Morgen den Gottesdienst der Altkatholiken zu besuchen. Wir trafen uns in der Augustiner-Kirche, die man ihnen eingeräumt hat. Die ganze Handlung machte einen angenehmen Eindruck auf mich. Äußerlich freilich ist wenig von dem Katholizismus gefallen. Die Bänke sind mehr zum Knien als zum Sitzen eingerichtet. Die Männer indes standen fast während der ganzen Handlung am Altar; die Frauen und Kinder knieten, die letzteren waren weit zahlreicher, als die Männer vertreten. Die Tracht des Geistlichen ist ganz die alte geblieben, auch die Chorknaben hat man beibehalten. Dagegen ist die Sprache in diesem Gottesdienst ganz deutsch.
Die Messe schien in abgekürzter Form zelebriert zu werden, ebenso das Opfer, welches zu meiner Verwunderung erst nach der Predigt vollzogen wurde. Der Geistliche trank dabei den Kelch, die Gemeinde war passiv, bis auf einzelne Responsorien, mit welchen sie zuweilen antwortete. Ein sicherlich großer Fortschritt ist es, dass die Gebete nicht abgeleiert werde, wie in der Katholischen Kirche. Sie werden zwar gelesen, aber in durchaus würdiger und andächtiger Weise. Die Predigt war sehr frei in Gedanken und Form. Sie schloss sich weder an das Evangelium noch Epistel an, die vorher verlesen wurden, sondern an einen frei rezitierten Spruch. Die Gedanken waren meist ethischer und äußerlich-kirchlicher Art, wenig oder kein tiefes religiösen Leben. Nach diesem ersten, einzigen Eindrucke zu urteilen, ist der Altkatholizismus auf halbem Wege stehen geblieben. Er hat sich nur durch Einreißen, auf negativem Wege gebildet, und das wird auch in diesem Falle sich als schädlich erweisen. Vielleicht treten der Sekte noch manche liberale Katholiken bei, aber ein rechtes religiöses Leben wird sich nicht aus diesen Trümmern werken lassen.

Wir sind wieder glücklich hier angekommen. Der Weg war etwas anstrengend, weil wir die ganze Strecke von Chur aus in einem Tage zurücklegten. Indes war uns das Wetter günstig; halb bewölkter Himmel und zuweilen ein sanfter Regen. Bis auf den Julier konnten wir im offenen Wagen fahren, und nach allen Seiten die herrliche Aussicht genießen. Die möglichst direkte Linie führte uns von unserm Nachtquartier über die Lenzer Heide, an deren Ende wir noch einige lohnende Blicke in den Schynpass tun konnten, der noch von vorigem Jahre her in der besten Erinnerung bei uns war. Solche Aussicht zur Herzensstärkung war auch notwendig, da die Strasse von Lenz nach Tiefenkasten sehr steil herabführt, und der sausende Galopp des Wagens wirklich zuweilen ein bangendes Gefühl aufkommen ließ. Indes ging Alles gut, auch die Fahrt vom Julier herab, der fast ebenso steil in das Engadin abfällt. Auf seiner Höhe spürten wir zum ersten Mal die wirklich kalte Luft, welche hier oben noch herrscht. Wir fuhren in unmittelbarer Nachbarschaft von frisch gefallenem Schnee. Hier in Sils ist es etwas besser, besonders da seit heute Morgen prächtiger Sonnenschein uns den ersten Tag versüßt. Ich bin in dasselbe Zimmer eingezogen, welches ich im vorigen Jahre bewohnte. Es hat seitdem Niemand hier gehaust; sogar eine Kleinigkeit von Wäsche, die ich hier hatte liegen lassen, fand sich noch vor. So genieße ich wieder den Blick auf den Corvatsch mit seinem schneeigen Gipfel, und auf einige weiße Hörner des Fexgletschers. Die Gesellschaft im Hotel ist noch sehr dünn. Außer dem unvermeidlichen Herrn Ebmeier, meinem Zimmernachbar, und einer älteren Dame sind wir vor der Hand die einzigen Deutschen. Einige englische Familien dominieren bei Tische und im Salon. Vielleicht lerne ich sie näher kenne, da zwei Mädchen die unter ihnen sind, sich durch musikalische Leistungen bemerklich machen. Unsere interne Familienstimmung ist gut, hoffentlich bleibt sie so.

Soeben habe ich mich aus dem Lokal, das sonst der Unterhaltung dient und Damensalon genannt wird, in mein Zimmer heraufgezogen. Die Luft war mir unten zu drückend; es schien Niemand rechte Lust zu haben sich über mehr als alltägliche Dinge zu unterhalten. So benutze ich das wenige Tageslicht, welches ich nach dem Essen noch hier oben als Reflex der Berge habe, zum Schreiben. Die Gesellschaft hat sich ein wenig zu unsern, d. h. der Deutschen Gunsten geändert. Ich speziell habe in einem Fräulein Krailsheim und ihrer Mutter eine angenehme Nachbarschaft erhalten. Wir unterhalten uns recht angenehm, was um so wertvoller ist, als keinerlei jugendliche Reize in Frage kommen. In nicht engen, aber doch näheren Verkehr bin ich mit Engländern, einer Familie Kingsburg getreten. Es sind einige sehr musikalische und hübsche Mädchen dabei. Leider scheinen sie kränklich und schwach zu sein, sodass wir schwerlich eine Tour mit ihnen zusammen unternehmen können.
Vor einigen Tagen machte ich eine interessante und ziemlich
anstrengende Hochgebirgstour. Ich hatte des Abends in gewohnter Weise
im Café gesessen. Dort traf ich den alten Lehrer Caviezel, einen sehr guten
Kenner der ganzen Umgebung. Auf eine gelegentliche Frage, ob der Crialetsch
schwer zu besteigen sei, antwortete er: Durchaus nicht. Er sei selbst
vor wenigen Tagen oben gewesen, um sich einen gewissen Stein in die
Sammlung zu holen, der dort gerade vorkomme. Er gab mir noch den
Rat den Berg von der linken Seite zu nehmen, wenn ich den Marmoré im Rücken hätte. Schon der nächste Morgen sollte mich auf
dem Wege sehen.
Ich nahm in früher Stunde mit meinem Nachbar Ebmeier das kühle Frühstück ein und macht mich bei frischem, halbklarem Wetter wohlgemut ans Steigen. Es war ein tauiger Morgen.
Das Wasser floss reichlicher an den sanften Abhängen des Marmoré,
und die Tropfen am Grase wetteiferten mit dem blauen und gelben
Blumen im Schmucke der Grashalden. Ein Regen am vorhergehenden
Tage hatte alle Menschentritte hier verwaschen. Um mich und in mir
war Alles frisch. Nach fast einstündigem Steigen stand ich auf der Höhe
des Marmoré. In vollen Zügen genoss ich die Aussicht auf das Engadin
und das Fexthal. Die Glieder, noch nicht recht an das Steigen gewöhnt,
fanden eine kurze Rast im tauigen Grase. Aber lange war hier
meines Bleibens nicht. Wohl entzogen die flüchtigen Wolken, die das
Bergell heraufschickte, eine Zeit lang meiner Blicken den steilen Gipfel
des Crialetsch; doch ließ ich den Mut nicht sinken.
Neu gestärkt ging
ich an den weiteren Aufstieg. Wie Caviezel geraten hielt ich mich links von dem zerklüfteten Grat, der in gerader Linie zum Gipfel
führt. Bald erreichte ich die erste Spur einer bedeutenderen Höhe,
ein kleines Schneefeld am Nordabhange des Berges. Ich konnte mir das
lange entbehrte Vergnügen nicht versagen, zur Kühlung ein wenig aus
Gottes Eisschrank zu naschen. Ich sollte für diesen Tag noch öfter
auf diese Erfrischung angewiesen sein. Je höher ich kam, um so
näher rückten die Wolken, die sich nicht hoben, wie ich, und wie
ich es erwartet. Bald stand ich mitten in dem Schleier der Berge,
die sie wirklich auch so sehr verhüllten, dass ich eine Zeit lang nicht mehr
sehen konnte, wohin ich meinen Weg wenden musste. Einen kleinen Fußpfad, der sich zuweilen zeigte, wenn ich
über Grassflächen kam, verlor ich so oft, dass ich schon lange ohne
ihn zu gehen angefangen hatte. So blieb mir inmitten der Wolken Nichts übrig,
als zu warten. Um die Zeit zu nützen, pflückte ich von den Blumen, die ich hier zum ersten Male sah, und
legte sie zum Pressen in ein Taschenbuch. Darüber hatte der
Wind mir wieder die Aussicht rein gefegt. Ich blickte nach unten
auf die lieblichen blauen Seen, und die weiß schimmernden Dörfer. Öfter aber sah ich nach oben, wo ziemlich steil über mir der dunkele
Gipfel mit seinen Rissen und Klüften sich scharf vom klaren
Himmel abhob. Ich konnte den Weg bis zur Höhe mit meinen
Blicken verfolgen, und hielt ihn für gangbar. Also frisch ans
Werk! Es ging aber so steil durch das Geröll, dass ich bald wieder
anhalten musste, um zu ruhen und zu überlegen, wie am besten weiter zu kommen sei. Das Klettern zwischen den Felsblöcken wurde mir nirgends erspart. Wenn hier einer der Felsen sich löste, und mich
mit sich zog, so war es um mich geschehen. Mit großer Vorsicht
also musste das lose Gestein betreten, jede eventuelle Deckung ausgesucht
werden. Was mir immer neu den Muth stählte, war die Voraussetzung, dass schon Andere vor mir den Weg gemacht hatten;
sonst wäre ich vielleicht hier noch umgekehrt. Der Gedanke daran
kam mir wirklich, als ich noch etwa 100 Meter vom Steintürmchen entfernt war, welches gerade über mir am Abhange geschichtet
war. Hier schien mein Weg zu Ende.

Eine breite Felsspalte
zu meiner Rechten führte nach oben. Aber dahin musste ich von
meinem Standpunkte einen gewagten Schritt tun. Ich wagte
ihn nicht, als ich zu meiner Seite hinab sah und entdeckte,
dass ich an einem entsetzlichen Abgrunde stand, indes ein Fehltritt mich hinabführen konnte. Ich zog darum einen weiteren und
beschwerlicheren Weg über glatte Felsen vor, über die ich auch glücklich
nach wenigen Minuten, während denen mir das Herz stärker schlug,
den Gipfel betrat. Mir war klar, dass ich denselben Weg um keinen
Preis zurücknehmen würde. Das war glücklicher Weise auch nicht nötig.
Meine Unerfahrenheit hatte mir viel überflüssige Anstrengung gemacht.
Ich hatte nach Caviezels Weisung den Berg weiter links umgehen
sollen. Von der Seite des Corwatsch her fällt der Crialetsch ganz allmählich ab, sodass dort der Graswuchs fast bis zum Gipfel reicht. Dass
ich dort einen besseren Abstieg finden würde, beruhigte mich völlig, und liess mich ungestört
genießen, was die Glieder und das Auge oben fanden.
Wie wohltuend war nach den Anstrengungen des letzten Steigens die Ruhe
der ausgestreckten Glieder. Da fühlt man, wie ganz anders der ausgestreckte
Körper sich erholt, als es beim Sitzen geschieht.

Bald war ich wieder
völlig bei Kräften, um mich an den Gipfeln und Tälern zu erfreuen, die nach
allen Seiten mich umgaben. Gerade vor mir, als ich heraufkam, lag der Absturz des mächtigen Corvatsch, von dem ich voriges
Jahr hernieder schaute. Noch um mehr als 1.000 Fuß überragte mich der
steile Gipfel, noch fast ganz in Schnee gekleidet. Ihm zur Rechten
reihten sich mit steilen Felswänden die Stützen des
Roseggletscher
an, den ich hier nur von der Rückseite sah. Die Schneeabhänge
führten über großartige Bergmulden hinüber zum
Fexgletscher,
der mit dem Fedoz als einheitliche Masse erschien. Noch bestand
die Schnee- und Eisverbindung mit dem Margna, welche wohl bald vor
der Sonne dem nackten, dunkeln Gestein wird weichen müssen. Dies
war mit dem mächtigen Abschluss des Margna der Anblick des
rechtseitigen Engadin. Gegenüber, jenseits des Tales, zeigte sich
in unzähligen Zacken und weißen Gipfeln die Julierkette von
Maloja bis weit über den Pirz Ort hinab, ein mächtiger Zaun
auf der Nordseite des Tals.
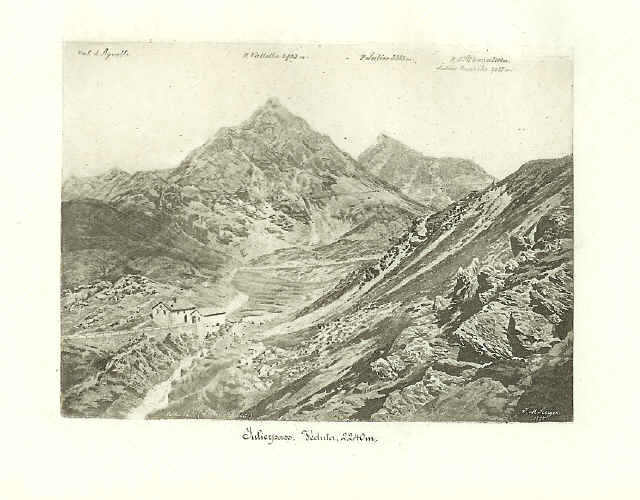
Und zwischen allen diesen Bergen sah
ich tief hinunter auf das liebliche Engadin, dessen Seen wie klare
blaue Augen heraufschauten. Wolken spielten neckisch zwischen
mir und dem Thale. Aber sie erhöhten den Reiz dessen, was sie
für Augenblicke verbargen. Sie meinten es besser, als der Maler, welcher
reizt und nicht sättigt, indem er verhüllt. Lange genoss ich in ungestörter Ruhe das liebliche Bild, und doch kurz im Vergleich zu der Zeit, die ich brauchte, um herauf zu kommen. 2½ Stunde musste ich steigen,
bevor ich mein Ziel erreicht hatte. Das Frühstück, das ich aus Vorsorge
eingesteckt, war schon unterwegs aufgezehrt.

Nun musste ich wieder an
das Hinabgehen denken, um nicht das Mittagessen zu versäumen, zu dem
ich erwartet wurde. Der Weg zur Linken, auf Silva Plana zu, war leicht.
Ich konnte ihn übersehen, soweit es nötig war. Mehr Genuss aber
versprach ich mir, wenn ich ins Fexthal herabstieg, wie ich mir
zu Anfang vorgenommen. Auch hier fiel der Gipfel allmählich ab;
und ich sah von oben einen der kleinen Seen, an denen ich der Karte
nach vorbeikommen musste. Ich beschloss also diesen neuen Weg zu
versuchen. Es hat einen mächtigen Reiz da zu gehen, wo man
sich selbst mit jedem Schritte den suchen muss, und wo keine
Spuren verraten, dass Menschen vor uns gewandelt sind. Ich nahm
auf dem Gipfel noch etwas Schnee zur Erfrischung, und stieg
hinab. Bald fand ich mich auf einem terrassenförmigen Hochplateau, welches ich schon oft von den gegenüberliegenden Bergen gesehen, und wohin ich mich bisher vergeblich gesehnt hatte. Immer
weiter hielt ich mich nach dem Fexgletscher hinein, bis ich unerwartet auf eine Herde und Sennhütte traf. Hier oben, wo der
Schnee Blumen und Kräuter küsst, wohnten auch Menschen. Das verriet, außer dem
fern liegenden Hause, die einfache Fassung der Quelle, in
der ich meinen Durst löschte. Die Sonne schien kräftig herab auf
die schattenlosen Berge, aber die dünne Luft und die Kühlung
vom Gletscher her ließen ihre Strahlen nicht lästig werden. Zu dem
war der Weg nicht ohne unterhaltende Neuigkeiten: Hatte ich vorher beim
Aufsteigen das seltene Glück, einen Berghasen in den Steinklüften verschwinden zu sehen, so fand ich jetzt Spuren der scheuen
Gämsen im Schnee. Der schrille Pfiff des Murmeltiers unterbrach
noch oft erschreckend die tiefe Stille. Auch an Vögeln fehlte
es nicht ganz. Die Bergfinken mit dem weißlichen Gefieder betrachteten Neugierig den ungeladenen, seltenen Fremdling. Das
Alles ließ mir den langen Weg, den ich schon zurückgelegt hatte, kurz erscheinen.
Ich ging einem Bergsattel zu, über den
nach meiner Meinung der Weg zum Thale führte. Ich betrat
ihn, und schreckte zurück, als ich vor mir einen steilen Absturz
erblickte, der über 1.000 Fuss tief zum Fexbache abfiel. Ich war
dem Gletscher ganz nahe, sodass unter mir schon das Sandlager
sichtbar wurde, welches der Gletscherabfluss an seinem Ursprunge
angeschwemmt hatte. Ich musste zurück, und nahm als Wegweiser
das Bergwasser, welches ich soeben überschritten hatte. Wo dieses
zu Thale ging, musste auch für mich ein Platz sein. Bald
führte dieser Weg mich enger hinein in eine Schlucht; das reißende Wasser hatte sie in den Berg hineingefressen. Fast
zu gewaltig war das Tosen und Rauschen des Baches. Doch war
diess der einzige Weg, auf den ich noch Hoffnung setzen konnte. Aber
auch sie schwand, als das Wasser plötzlich in Kaskaden über den
Fels hinabstürzte. Da waren meine Kenntnisse und Hoffnungen
zu Ende. Schon weit war ich herabgestiegen und doch blieb mir Nichts
übrig, als zurückzukehren und vielleicht den ganzen Weg zu wiederholen, den ich heute zurückgelegt hatte. Dann konnte ich unmöglich Mittags
zu Hause sein, und musste besorgen, dass man mich vom Hotel aus
suchen würde. Hier half aber langes Reflektieren und stumpfsinniges
Brüten über die schlimme Lage Nichts.
Der Körper brauchte einige
Minuten Erholung, und diese benutzte ich, um den besten Weg
ausfindig zu machen, den ich einschlagen würde. Es führte nur einer
zur Höhe, wo ich weiter zu kommen hoffte. Ein kleines Bächlein hatte den steilen
Abhang etwas zerrissen, und damit festere Stützpunkte für den Fuß geschaffen. Mit Mühe ging es wieder bergauf.
Die Sorge, einen neuen Fehlgang zu tun, und auch hier wieder
vor einer getäuschten Hoffnung zu stehen, bewegte mich mächtiger
als vorher, wo solche Erfahrungen fehlten. Indes sollte ich bald wieder
mit der besten Zuversicht erfüllt werden. Oben angekommen hörte
ich plötzlich den Zuruf eines Hirtenbuben, der mich von weitem
erblickt hatte, und einen Strauss Edelweiß in der Hand sich mir
näherte. Es war ein süßes Gefühl, in dieser Verlassenheit einen
Menschen zu sehen. Ich wusste, dass er mich einen Weg zum
Thale führen konnte. Gern nahm ich gegen eine Gabe die
Blumen, die ich sonst immer von mir gewiesen hatte, weil ich sie
selbst pflücken wollte. Zwar konnte ich mit dem Buben mich nicht
unterhalten, da er nur romanisch sprach, aber so viel verstand, wohin
ich wollte, und dass ich ihn zum Führer brauchte. Er war bereitwillig,
und schritt voran. Ich allein hätte den Weg nie gefunden, auf dem er
mich führte. Gerade über dem Wirtshaus am Dorfe Curtins, da
wo am Berge eine kleine Hütte steht, kamen wir ins Tal, und
kaum hatte ich altbekanntes Gebiet betreten, als wir uns trennten. Er ging
in seine Berge zurück, und ich, müde aber herzensfroh, in dies unser
Sommerdomizil.

In der kurzen Zeit unseres Hierseins hat sich schon einmal unsere Gesellschaft geändert. Bis vor wenigen Tagen freuten wir uns der Bekanntschaft einer englischen Familie Kingsburg. Sowohl die Mutter, wie die beiden Töchter waren durch ihr anspruchloses Wesen und ihre Freundlichkeiten recht lieb geworden. Sie sind seit Freitag in Silvaplana, wo ich sie hoffentlich noch einmal sehe. Außer ihnen verkehrten wir während einiger Tage näher mit einem Frl. v. Rudolff aus Arnsberg, welche uns immer belustigte und musikalisch angenehm unterhielt. Sie ging schon vor jenen zu ihrem und unsern Bedauern fort, nach Churwalden. Mit allen diesen Entfernten unternahm ich und Wilhelm in voriger Woche eine Tour nach dem Cavlocciosee. Wir haben uns sehr dabei belustigt. In die Gesellschaft nun eingetreten ist ein Maler, Prof. Kaulbach aus Hannover, der Neffe des berühmten Kaulbach. Er mag ein tüchtiger Künstler sein, das weiß ich nicht. Als Mensch aber gefällt er mir wenig. Er ist samt seiner Frau zu anspruchsvoll, vielleicht allerdings in Folge nervöser Gereiztheit, an der er offenbar stark leidet. Ich komme nur ganz flüchtig mit ihm in Berührung und halte mich mit den Tischgesprächen lieber an den alten Geographen Zigler, einen interessanten alten Mann. Es ist staunenswert, welche Frische dieser mehr als 80-jähriger Greis besitzt, und welche vielseitigen Kenntnisse sich in diesem ehrenvoll grauen Haupte sich finden. Bei ihm forsche ich täglich nach interessanten Neuigkeiten in Bezug auf die Gegend.
Vorgestern habe ich wieder eine sehr lohnende Bergpartie ausgeführt, welche ich für diesen Sommer auf mein Programm geschrieben hatte. Mit Eggenberger, meinem Führer seit vorigem Jahre, bestieg ich den
Margna. Es war ein herrlicher Tag. Bald nach drei Uhr stand ich auf; Tag und Nacht stritten noch mit einander, doch lies das gleichmäßige Aussehen des graublauen Himmels auf einen schönen Tag schließen. Als ich zum Frühstück antrat, bestätigte der Führer diese Erwartung. In brüderlicher Eintracht, wie sie sich mit dem gleichaltrigen Führer von selbst findet, tranken wir den Kaffee, den der vorsorgliche Hausknecht uns bereitet hatte. Um vier Uhr brachen wir auf. Nach kurzer Wanderung sahen wir, dass auch die Sonne aufgestanden war. Sie vergoldete die äußersten Spitzen der umliegenden Berge. Ein wolkenloser Himmel schaute in die Täler herab und machte uns dadurch den Weg in der morgendlichen Kühle noch angenehmer.
Eggenberger führte durch das Fexthal und in den vorderen Teil des Fedoz. Auf einer primitiven Brücke überschritten wir den brausenden Fedozbach, der sich schon tief in die obere Talsohle eingefressen hat. Alle rauen Felsen sind rund abgeschliffen, und darüber darf man sich nicht wundern, wenn man sieht, mit welcher Schnelligkeit dieser Gletscherabfluss zu Thale eilt, und mit welcher Wucht er 1.000 Meter weiter den Wasserfall von Isola bildet. Am jenseitigen Ufer standen wir am Fuße des Margna, eines 3150 Meter hohen Berges, dessen unveränderlicher Gletscher, an seinem Gipfel beginnend, charakteristisch für die ganze Umgebung ist. Wir stiegen Anfangs einen kleinen Pfad hinauf. Er führte zu italienischen Sennhütten. Schon von Weitem kündigten uns den Bewohnern zwei offenbar sehr bissige Hund an. Sie wurden bald beruhigt; aber nicht etwa durch die freundliche Stimme einer lieblichen Sennerin. Ein hässlicher Mann mit struppigem Barte war das einzige menschliche Wesen, das hier oben hauste. Indes auch von ihm hörten wir ganz gerne nach kurzer Rast ein "buon riturno"!
Noch waren wir ganz munter; der Mount Ota hatte uns bisher Schatten gespendet. Aber je höher wir kamen, um so tiefer stieg die Sonne herhab. Sie hatte sich schon eine Stunde am Gipfel satt gesehen. Bald sollte sie uns lästig werden. Sie stand gerade über unserm Scheitel, und das Gestein gab die Strahlen zurück, die es empfing. Lange noch freuten wir uns an den Abhängen, rot von der Menge der Alpenrosen, und hier und da mit einer blauen Gentiane oder einem weißen und gelben Ranunculus geschmückt. Nach einer Stunde hörte aber diese Freude auf. Der Schnee duldet wenig Leben in seiner Nachbarschaft. In allen tieferen Schluchten der Felsen hielt er sich noch; freilich wird seines Bleibens nicht mehr lange sein; die munteren Bäche führten ihn unvermerkt in das Tal hinab. Da unser Blick in der Nähe wenig fand, schweifte er öfter ins Weite, und da gab es Herrlichkeiten genug zu schauen. Links von uns zog sich ein breites und viele hundert Meter hohes Schneefeld zum Gipfel hinan, wo es sich anschloss an die weißen Höhen, welche den Margna mit dem Fedozgletscher verbinden. Grausig einsam und wild liegt das Tal zu unsern Füssen; wenig grüne Matten geben den Herden und Gämsen Nahrung. Durch wild zerrissenes Felsengewirr Klettern wir zu einem kleinen Vorsprung empor. Wir hatten ihn zu kurzer Rast ausersehen.
Der Blick öffnet sich hier zum ersten Male auf den Gletscher des Margna, und weiter zur Rechten auf das liebliche Engadin. Ungehindert schweift das Auge über das ganze obere Engadin von Maloja bis Zernetz. Bei solchem Anblicke zu ruhen und mit Veltliner Wein die Glieder zu stärken, ist zwei- und dreifacher Genuss. Eben als wir an die Fortsetzung unseres Weges denken wollten, entdeckten wir, dass außer uns Andere den Gipfel unsers Berges zum Ziele genommen hatten. Eggenberger erkannte in ihnen einen Führer aus St. Moritz mit einem Fremden. Sie gingen einen sehr schwierigen Weg. Das ganze Schneefeld, welches sich zu unserer
Linken den Berg herabzog,wollten sie hinaufsteigen. Und das war nicht das Schwerste, wie der Führer sagte. Oben angekommen fanden sie steile, fast unzugängliche Felsen. Ich hielt es für unser Pflicht, die Fehlgegangenen zu warnen. Mein Führer aber wollte aus einer alten Eifersüchtelei Nichts davon wissen. Ich tat es deshalb auf eigene Faust durch Zurufen und Winken, indes ohne Erfolg. Jener Führer wollte sich offenbar nicht die Blöße geben, auf einem falschen Weg gegangen zu sein.
Wir machten uns wieder auf. Bald ging es durch Schnee, der heute besonders weich war, da in der Nacht fast gar kein Frost stattgefunden hatte. Bald kletterten wir durch zerrissen Felsen. Der Gletscher blieb immer zu unserer Rechten. Wir konnten ihn trotz der Nähe nicht benutzen, da derselbe sehr steil abfällt. Gegen halb zehn Uhr erreichten wir glücklich den Gipfel; wir begrüßten ihn mit Freudenrufen, und das nicht umsonst. Unbegrenzt war die Aussicht nach allen Seiten. Der Himmel war völlig klar geblieben. Nur in den Tälern vor dem Montes Rosa, dessen Kette wir mit bloßem Auge ganz überblicken konnten, lagerten einige Wolken, rosig angehaucht, wie die Berge, sodass sie schwer von diesen zu unterscheiden waren. Nichts aber hemmte den Blick zu unsern Füssen, und in die weitere Umgebung. Vor und unter uns lag die Disgrazia-Gruppe, die ich zum ersten Male völlig überschaute. Starr vor Schnee und Eis ragten ihre Gipfel zum dunkelblauen Himmel empor; die meisten von ihnen höher, als unser Standpunkt.
Aus dem Gewirr der Berge aber wälzte sich ein weißer Strom auf uns zu: der Forno-Gletscher. Das Rauschen des Wassers, das aus ihm hervorbrach, klang wie die Brandung des entfernten Meeres. In unmittelbarer Nachbarschaft dieses starren, großartigen Bildes lag vor uns eine Idylle, lieblich anzuschauen: das Tal des Cavlocciosees. Das lichte Blau des seichten Ufers ging nach der Mitte zu in ein unergründliches Dunkel über. In Sicherheit für lange Zeit liegt dort die Urkunden-Flasche, die wir neulich beim Spaziergange versenkten.
Wir brauchten uns von dieser Westseite unserer Aussicht nur umzukehren, um ein nicht weniger schönes Bild vor uns zu haben. Jenseits des Fexthales und seines Gletschers baut sich die Bernina-Gruppe auf, von hier nicht in so schönen Amphitheater, wie am Morteratsch, und doch imposant durch ihre großen Verhältnisse und die vielen weißen Gipfel. Nach Süden begrenzen den Horizont die Berge jenseits des Veltlin; das Tal zu ihren Füssen, von dem wir nur den Oberen Teil erblicken, ist in ein duftiges Blau gekleidet. Nach Norden aber kommt das Auge nicht leicht in weite Fernen, es muss in die Augen des Engadin, die blaugrünen Seen schauen. Es sollte mich nicht wundern, wenn ich schon zu tief hineingeblickt hätte. Als wir schon mitten im Genuss unserer Bergeshöhe standen, kamen die beiden vermeintlichen Irrgänger oben an. Sie hatten also doch einen Weg gefunden. Aber wie, das sagte uns die Ermüdung, mit der sie den Gipfel betraten. Wie man vor Durst lechzend sich auf die ersehnte Quelle stürzt, so warfen sie sich bei der Ankunft auf den Boden. Ich kenne aus ähnlicher Erfahrung das wohltuende Gefühl, welches man empfindet, wenn die müden Glieder sich lösen und dem Boden anschmiegen dürfen. Das etwas begraste Gestein des oberen Margna deuchte den beiden sicherlich die lieblichste Ruhestätte, die sie seit Langem gefunden. Der Fremde war ein Holländer, mit dem ich eine Zeit lang die Aussicht teilte, während die Führer in ihrer Weise mit einander sprachen. Sie gingen schon vor uns wieder hinab, weil ein Freund im Tale auf ihre Rückkunft wartete. Er war vor der großen Steigung zurückgeschreckt.
Ich konnte mich erst nach fast zweistündigem Aufenthalte zum Absteigen verstehen, und dann ging es schneller, als herauf, auf demselben Wege hinunter. Bald aber gingen wir durch ein Felsenlabyrinth weiter hinein nach dem Fedoz, wo wir auf das Schneefeld gelangten, welches den Andern zum Aufstieg gedient hatte. Hier sollte ich ein neues Bergvergnügen kennen lernen. Das Schneefeld wurde unter einem ziemlich steilen Winkel zum Tale geführt. Wir benutzten den Fall zu schneller Beförderung. Der Führer setzte sich vor mir auf den Schnee und glitt mit ziemlicher Schnelligkeit auf der Fläche hinab. Ich versuchte ein Gleiches, und siehe da; auch bei mir stellte sich ein sanftes Gleiten ein. Je länger, um so schneller ging die Fahrt. Allzu große Eile wurde durch den Alpstock gehemmt, der unter den Arm gehalten eine Furche im Schnee zog. So kamen wir weit hinunter bis in die Weideregion, von wo wir auf dem alten Wege hierher zurückkehrten.

Wir sind jetzt schon über vier Wochen unterwegs, und doch ist mir die Zeit bisher noch nicht zur Last geworden. Im vorigen Jahre war es anders. Ich freue mich, dass ich mich jetzt wohler fühlen kann. Offenbar ist ein Wechsel in mir vor sich gegangen, denn in allen Verhältnissen, in denen ich stehe, sehe ich Nichts verändert. Ich lasse mir die Dinge nicht mehr so zu Herzen gehen. Warum auch sich ereifern, wo Nichts zu ändern ist. Augenblicklich wird die Tatkraft einigermaßen durch das Wetter zurückgehalten. Wir freuen uns in diesem Jahre schon, wenn wir den blauen Himmel über uns sehen, und nehmen gern kühlen, ja kalten Wind mit in den Kauf. Gestern, wo ich im Fexthal war, und dann zwischen die beiden Eismassen des Fex und Fedoz hinein stieg, hatte ich sogar zuweilen leichten Schneefall. Trotzdem hat mir der einsame Spaziergang wohl getan. Auch in anderer Hinsicht hat er gute Früchte getragen. Ich habe sehr schönes Edelweiß geholt und im Verein mit Alpenrosen noch gestern Abend an Martin abgeschickt. Die Blumen waren für ihn, die Familie
Vietor und Ringwald bestimmt. Ich hoffe, dass sie noch Freude machen werden.
Bei meinen Touren bin ich jetzt fast immer allein. Aus der Gesellschaft im Hotel werde ich schwerlich mit Jemand intim werden. Die Leute wechseln zu oft. Für einige Tage war ein Major Bopp aus Stuttgart ein ganz angenehmer Verkehr. Er hatte einen 16-jährigen Sohn bei sich, der in mehr als einer Beziehung interessant war. Ich habe eine Ruderfahrt nach Isola mit ihm gemacht. Eines Abends konnte ich ihm ein wenig tiefer ins Herz sehen, als dies sonst bei dem Hotelleben angeht. Wir standen vor der Haustür des Hotels, wo das Schutzdach den reichlich nieder strömenden Regen abhielt. Gleichgültige Dinge waren unsere Unterhaltung, als plötzlich die Abendglocke geläutet wurde. Der Jüngling verstummte, und ich sah, dass mehr als nachdenkliches Schweigen der Grund dazu war. Bald sagte er mir auch selbst, dass er bei diesem heimatlichen Klange zu beten gewohnt sei. Das führte uns bald tiefer hinein in ein Gespräch über Religion. Ich erfuhr, dass der Vater Katholik sei, aber seine Kinder in dem protestantischen Glauben seiner Frau habe erziehen lassen. Die Mutter war vor kurzem gestorben. Das beste Erbteil, was sie ihren Kindern hinterlassen hatte, war offenbar das gewesen, wovon ich soeben ein Zeugnis gesehen. Weiter forschend fand ich bei dem jungen Menschen ein wunderbar entwickeltes religiöses Leben. Gott behüte seine Wege besonders hierin. Vater und Sohn sind sehr plötzlich abgereist, nachdem ich ihnen vorher versprochen, vorkommenden Falls sie in Stuttgart aufzusuchen.
Augenblicklich verkehre ich noch am meisten mit Prof. Kaulbach, einem Maler aus Hannover, der mir jedoch nicht sehr sympathisch ist. Angenehmer ist seine Frau und sein kleiner Junge. Die Beziehungen bleiben jedoch nur sehr oberflächlich; sie gehen nächstens wieder weg. Bei Tische ist es nicht zu lebendig um mich her. Gegenüber sitzt eine Frau Warburg mit Tochter aus Hamburg. Sie tragen unverkennbar jüdischen Typus, scheinen aber getauft zu sein. Ob dasselbe auch bei meinem rechten Nachbarn, Frau Krailsheim und Tochter aus Frankfurt der Fall ist, scheint mir fast zweifelhaft. Der Verkehr mit ihnen ist ganz angenehm. Am meisten spricht mich die Abendunterhaltung im Café an, wo wir oft mit den Männern aus dem Dorfe zusammensitzen. Die Fremden und die Einheimischen verkehrten überhaupt in diesem Jahre mehr miteinander, als voriges Jahr. Der alte Herr Zigler, der fremd und einheimisch zugleich war, ist seit vorgestern weggegangen. Wir haben fast alle in ihm einen liebenswürdigen Gesellschafter verloren. Durch ihn lernte ich vor ca. acht Tagen einen jungen Ingenieur kennen. Derselbe wohnt augenblicklich hier, um die Gegend in Zeichnung und Photographie aufzunehmen. Dieser Herr Simon scheint ein recht tüchtiger Mensch zu sein. Sein Eifer ist wirklich bewundernswert. Er ersteigt fast alle Tage, wo das Wetter es zulässt, einen der hohen Gipfel unserer Umgebung, von denen ich in jeder Woche immer nur einen anzugreifen wage. Er hat sich gut und höchst praktisch für Bergtouren eingerichtet. An ihm sehe ich erst, wie viel mir zum Bergsteiger fehlt. Seinen Führer hat er sich aus St. Gallen mitgebracht; richtiger gesagt ist er nur sein Berggenosse, denn Simon hat selbst ein gutes Auge und reiche Erfahrung im Steigen. Er gedenkt das Engadin plastisch darzustellen. Im nächsten Jahre wird seine Arbeit auf einer Ausstellung in Zürich zu sehen sein. Ich werde es schwerlich dort ansehen können, will also das Tal noch in natura genießen, so lange und gut ich kann.

So trübe und rau, also recht ungünstig, das Wetter auch ist, so habe
ich doch die wenigen schönen Tage, welche dazwischen eingestreut
waren, gut genützt. Nicht mit Wilhelm. Derselbe ist diesmal noch
schwerer von seiner Mutter und Margarethe, ihrer Begleiterin, weg zu bringen.
Ich aber mag nicht alle Tage mit den Drei spazieren sitzen.
Als sich darum vorigen Donnerstagabend nach allen Anzeichen
gutes Wetter meldete, beschloss ich eine Tour. Diesmal in Gesellschaft von Caviezel, eidgenössischem Wetterschmecker, wie er sich selbst
nennt. Sein eigentliches Geschäft ist die Unterweisung der Jugend.
Aber diese hat während der vier oder fünf schneefreien Monate des Jahres Ferien;
darum war es für ihn wie für mich gleich wenig Zeitverlust, in die Berge zu streifen. Ich gehe dabei, um in die weite
Welt zu schauen, die hier so schön ist. Bei ihm ist der Zweck
jedenfalls kein anderer, aber er hatte doch noch einen Vorwand.
Gewisse Steinarten zu suchen war unsere Arbeit auf dem Wege.
Wir gingen zu diesem Zwecke auf den Septimer, die alte Römerstrasse entlang, von der ich schon im vorigen Jahre einen Teil gesehen.
Mit Herrn Heffter betrat ich damals in Bergell diese alte Denkwürdigkeit.
Ein sonniger, klarer Morgen grüsste uns bei dem Abmarsch aus
unserm freundlichen Dörfchen. Caviezel hatte das Ränzel, zur Aufnahme der Findlinge bestimmt, auf den Rücken genommen. Einstweilen fand man darin kräftigen Inferno und was sonst
zur Leibes Nahrung und Notdurft gehört. So ging ich frei und ungehindert. Wir schlugen den Weg jenseits des Sees nach
Maloja
ein und fingen an der Wendung der Strasse an zu steigen; den
Bach, der zu unserer Linken murmelte, kannte ich. Voriges Jahr
stiegen hier um Mitternacht drei einsame Wanderer auf den Greves Alvas. Ich, als der Letzte unternahm damals mit Herrn
Hieber [?] aus Freiburg meine erste Bergtour. Während ich
damals wenig von dem sah, was um mich war, sah ich mich
bei dem heutigen Gange in einem saftigen Wiesentälchen.
Ganz wie der Schwarzwald mutete mich die Gegend an. Wäre
der Margna mit seinem schneeigen Gipfel nicht über den grünen Bäumen erschienen,
ich hätte eine vaterländische Gegend hier vermuten können: Das Dorf Greves Alvas war bald
passiert. Leer
war es in den kleinen Häusern und auf den Strassen, wenn man
die Rasenplätze und Düngerstätten so nennen will. Alle Bewohner
waren im Heu, und nicht sie allein. Bei ihnen sahen wir,
wie man es um diese Zeit im Engadin gewöhnt ist, viele
Italiener, die als Arbeiter in die Heuernte kommen. Unser
Weg führte zunächst in der Richtung des Longhinsees. Aber ehe
wir soweit kamen, mussten wir einen Augenblick rasten. Nicht aus Müdigkeit, wir
waren erst eine Stunde gegangen. Aber vor unsern Augen war eine so wunderschöne Berglandschaft aufgetaucht, dass
ein wahrer Stumpfsinn dazu gehört hätte, hier weiter zu gehen,
ohne mit vollen Zügen das genossen zu haben, was Gott uns hier
gab. Unter einem höheren Vorsprunge der Julierkette stehend,
wenn ich nicht irre, dem Monte Rotundo, erblickten wir - uns
gerade gegenüber die altbekannten, ruhigen Formen der
Margna.
Zu beiden Seiten war dieser nahe Gipfel von einer mächtigen
Kette weißer Bergspitzen flankiert. Zur Rechten die Berge um
den Disgrazia, die uns so selten zu Gesichte kommen, und links,
durch Fedoz und Fex verbunden, der
Bernina und seine Trabanten (Berninamassiv
und
Berninagruppe von Nordosten mit Piz Scerscen, Piz Palü, Bellavista, Piz Zupò,
Crast'Agüzza, Piz Bernina und Piz Morteratsch).
Das Alles lag im schönsten Sonnenlichte vor uns, klar, jeder
Gipfel vom blauen Himmel und von seinem Nachbar scharf
zu unterscheiden. Und nicht genug mit dieser Klarheit; der kundige
Gefährte wusste hier alle die einzelnen Spitzen genau zu nennen. Wir brauchten keine Karte auf dem ganzen Wege,
die meisten
dieser ehrwürdigen Häupter hatte Caviezel schon erstiegen, und
von manchem wusste er interessante Dinge zu erzählen.
Unser Weg führte uns allmählich hinüber, gegen
Maloja zu. Hier
sollten wir bald Zeugen eines großartigen Stilllebens werden. An
eine Wiege traten wir, und sahen in friedlicher Ruhe das Kind,
welches dort ruhte. Aber nicht in Flaum gebettet.
Zwischen den
steilen Felsen, die von dem Greves Alvas senkrecht 1.000 Fuß abfallen, und zwischen dem sanfter sich abdachenden Longhin schaut zwischen
großen Felsblöcken der Inn zum ersten Male mit
blauem Auge in die Welt. In einem See von etwa ½ Stunde
Umfang sammeln sich die Gewässer, die von allen Seiten her
den schwindenden Schneefeldern entsickern. Spiegelglatt lag das Wasser vor uns,
und in ihm das Bild der erhabenen Natur.
Hier machten wir die erste Rast für unsere Glieder und
erleichterten zugleich Flasche und Ranzen um einen kleinen Teil
ihres Inhaltes. Dann ging es wieder in mäßiger Steigung bergan. Da, wo die Einsattelung am tiefsten ist, zur Rechten
des Longhin, erreichten wir den Kamm. Mit einem Male
tat sich ein neues Bild vor unsern Blicken auf. Ich hatte Zeit, es mir genügend einzuprägen, während Caviezel
nach Steinen suchte, deren Vorkommen auf dieser Höhe ihm unzweifelhaft war. Er hämmerte, und suchte wieder, aber immer noch
nicht mit dem rechten Erfolge. Mir war diese Verzögerung nicht
unangenehm. Denn von hoher Warte sah ich hinunter auf
die alte Septimerstrasse und jenseits in die dort sich auftürmenden
Gipfel. Wir befanden uns auf einem interessanten Punkte.
Da wo wir beim Heraufsteigen eben die letzten Schneefelder passiert hatten, lag
zwischen dunkelgrünem Serpentin der Ursprung des Inn. Der Schnee aber, welcher am Nordabhange des
Kammes bis zu meinem Felsensitze das Gestein bedeckt, speiste schmelzend die Quellen des Oberhalbsteiner Rheines. Zur Linken
um einen Büchsenschuss weit war der Anfang eines anderen Tales, wo einem dritten
großen Stromgebiet eine jugendliche Kraft zugeführt
wird. Dort entspringt die Maira, die das
Bergell durchfließt,
und dem Comersee zueilt.
Wir schritten hinab, für kurze Zeit Abschied nehmend von
dem freundlichen, wenn auch in dieser Höhe kümmerlichen Leben
der Pflanzenwelt. An einem so hohen Nordabhange unterbricht
nur der leuchtende Schnee das einförmige Gestein. Je weniger
Schönes wir aber zu unsern Füssen sehen, umso herrlicher
wurde der Blick in die Ferne. Wir konnten weithin das Oberhalbsteiner Rheintal überschauen, und jenseits standen
in reinem Blau die mächtigen Bergzinnnen vom Julier
an, den wir sonst nur von der Südseite zu sehen gewöhnt
sind bis an das Stätzerhorn, welches die Lage der Lenzer Heide markiert. Wir würden von unserer Höhe auch einen weiten
Blick in die Berner Alpen haben, aber die großen Formen
des Piz Platta und seiner Untergebenen gebieten unserm Auge
Halt.
Als wir den grünen Rasenteppich wieder erreicht hatten, wäre
ich gerne zu einem frugalen Bergimbiss übergegangen, aber mein Begleiter mit dem
Futtersacke schien in seinen Gedanken wenig Platz für solche Nahrungssorgen zu haben. Er
wusste allmählich auch meinen Gedanken eine andere Richtung
zu geben.
Wir näherten uns der Passhöhe des
Septimer. Es sieht jetzt wüste und leer auf der alten Verkehrsstrasse aus. Pferde
weideten in Herden an den Abhängen. Sonst pflegt italienisches Rindvieh hier einen Sommeraufenthalt zu
nehmen. In diesem Jahre aber
war diesem der Zutritt über die Grenze verwehrt, weil in Italien
die Klauenseuche grassiert. Außer wenigen Hirten waren diese Pferdemütter mit ihren Jungen die einzigen lebenden Wesen, die wir
hier oben fanden. Selbst das Haus auf der Passhöhe war öde
und unbewohnbar. Seine Mauern sind gebrochen. Aus einer Herberge
für müde Wanderer war es im Mittelalter zu einer Räuberhöhle
geworden. Hatte eins der durchziehenden Heere die verdiente Strafe über das
Raubnest gebracht, oder hatten die friedlicheren Gemeinden in der Umgebung die böse Nachbarschaft ausgerottet, wir
erfuhren Nichts darüber von dem wüsten Steinhaufen, bei dem wir einen
Augenblick Halt machten. Caviezel vermutete hier richtig eine
seltene Steinart. Wir brauchten nicht lange nach den Steinbrüchen zu suchen. Das zerstörte Haus selbst war zum Teil daraus
gebaut, und bot uns schon ein ziemlich handliches Material.
Wir schritten von hier ab auf der
Septimerstrasse weiter. Erst in
sehr mäßigem Abstieg, aber je weiter wir kamen, umso steiler
wurden die Abhänge, welche die Strasse zu überwinden hatte. Es
ist ein wirklich kunstvolles Bauwerk gewesen. Noch jetzt lag an
den meisten Stellen das Pflaster bloß. Grosse Steinplatten, meist
Serpentin, wie die ganze Umgebung, hatten den Jahrhunderten, ja fast Jahrtausenden getrotzt. In den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung soll
dies nämlich der beliebteste Pass der Römer gewesen sein. Von besonderem
Interesse ist die Art, wie die Römer solche Stellen überwunden haben, wo der nackte Fels zu Tage tritt. Dort konnten sie
natürlich nicht pflastern. Sie haben einfach den Felsen ausgehauen und geebnet. Ein wenig Geröll und Erdreich, jetzt durch das
Wasser hinweggewaschen, mag diesen harten Untergrund der Strasse gemildert haben. Immer führte der Weg an dem klaren Wasser der Maira entlang, mit ihr den mehr oder weniger starken Fall teilend. Je weiter
abwärts wir kamen, um so mehr gab es hierbei Bemerkenswertes zu sehen.
Da, wo unser Tal in das wilde und einsame Marzoz-Tal mündet, war offenbar die Passage am schwierigsten.
Die hohen Grassabhänge trugen die unverkennbaren Spuren häufiger
Lawinen. Da musste die Strasse an der steilsten Stelle, wo der schroffe
Fels dem Schnee kein Lager gab, herabgeführt werden. Und das ist
geschehen. In ganz kurzen Serpentinen schlängelt sie sich ins
Tal. Zur Seite braust die kräftiger gewordene Maira, zu
welcher die Felsen am Rande der Strasse steil abfallen. Hier
mögen oft Menschen und Tiere einen jähen Tod gefunden haben, wenn
Glatteis den Verkehr noch gefährlicher machte. Erzählte mir doch
mein Begleiter, dass man im Mittelalter an einer etwas weniger
schroffen, aber doch sehr steilen Stelle, die Saumpferde und ihre
Last einfach über den Rand der Strasse hinabgestoßen habe. In
dem weichen Schnee soll dieser Sturz weniger gefährlich gewesen sein, als der mühselige Abstieg auf dem übereisten Pflaster.
Unser Weg hinab ging ebenfalls mühsam vonstatten. Wir verschmähten den bequemeren
Fußweg, um auf der denkwürdigen Römerstrasse zu bleiben. Das Pflaster verfehlte jetzt freilich seinen
Zweck, den Weg zu ebnen. Es glich eher einer Treppe, deren ungleiche und oft
nach oben zugespitzte Stufen unsere ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nahmen. Wir
ließen uns indes das
nicht verdrießen; schauten links und rechts, ob nicht vielleicht
noch ein alter Römer oder wenigstens ein Teil seiner Rüstung
am Wege läge. Wir hatten dabei freilich nicht daran gedacht, wie
schon viele Jahrhunderte vor uns Andere sich eines solchen Fundes
würden gefreut haben.
So kamen wir allmählich an die Stelle, wo das Tal der Maira
sich gegen das Bergell öffnet. Ein liebliches Bild lag da plötzlich vor unsern Augen, die mehrere Stunden lang sich an die
wilde Einsamkeit des Bergpasses gewöhnt hatten. Es war
ein Ort zum Ausruhen wie geschaffen. Uns zur Seite die
brausende Maira, zu Füssen das grüne Bergell und gegenüber
die schönen Formen der Disgrazia-Gruppe (Monte
Disgrazia und
Foto). An einem großen
Granitblock, der dem Juliergebirge entstammte, ließen wir uns zum
einfachen Mittagsmahle nieder. Ein fremder Findling, so sagte
der mineralkundige Caviezel, war dieser unser Hotelwirt, und doch
hatte er offenbar zu den Zeiten der alten Römer hier gelegen. Er mochte,
zur Linken des Aufsteigenden, schon oft zur Rast eingeladen haben. Unser Diner
(= Mittagessen) bestand nur aus Brot und etwas Fleisch, und doch war
es für uns ein köstlicher Genuss. Ob zu dieser Wertschätzung des
Wenigen mehr der gute Appetit verhalf, den der lange Weg gebracht
hatte, oder die reizvolle Umgebung, das mag dahin gestellt sein,
auch ob der Wein, in dem nahen Bache verdünnt, hierdurch besser
und wohlschmeckender geworden war. In der heitersten Stimmung tranken wir ihn einander zu, bis der letzte Tropfen geschwunden war.
Die leere Flasche blieb am Wege für einen armen Hirten. Wir
aber stiegen tiefer hinab, mit jedem Schritte spürend, wie die frische
Bergluft im Tale gemildert wurde. Wie mag der aus dem kalten
Helvetierlande zurückkehrende Römer sich gefreut haben, wenn
diese linderen Lüfte ihn an die nahe Heimat erinnerten. Schon
traten wir wieder in den Wald ein. Ich staunte über den üppigen Wuchs der Bäume,
der im Engadin nirgends zu finden ist. Besonders die Riesentanne, hier Wettertannen genannt, weil bei
Unwetter das Vieh sich darunter flüchtet, waren ein ganz ungewohnter
Anblick. Wir Beide hätten einen solchen Baum mit ausgestreckten
Armen kaum umspannen können.
Durch das Tannendunkel führt die Septimer-Strasse hinab nach
Casaccia. Wir wollten nicht ganz hinab gehen, da schon die Mittagsstunde vorüber war. Darum
verließen wir in der halben Höhe die
Strasse und gingen zur Linken gegen Maloja hin. Bald fanden wir den Wald durch
üppige Mähwiesen unterbrochen. In malerischer Umgebung lagen Heuställe am Rand des Waldes, und eine Aussicht bot
sich von hier, dass wir beide überrascht in einen Ausruf der Freude ausbrachen. Unmittelbar vor uns der grüne Wiesenteppich, der bis
zum Dorfe Cassaccia hinabreichte. Jenseits aber baute sich um den
Albignagletscher eine Gebirgswelt auf, wie ich sie schöner
noch nicht gesehen. Das warme Licht des Nachmittags war über
die weißen Spitzen und grünen Hänge gegossen. Wir mussten noch einmal rasten, um
diesen Anblick ganz in unsere Seele aufzunehmen. Caviezel suchte sogar mit künstlerischer Hand das Bild
auf das Papier zu fesseln, während ich nur schauen und schauen
konnte. Es war ein glänzender Abschluss Alles dessen, was
wir heute gesehen hatten, und nur ungern wandten wir uns zum
Weitergehen. Unser Weg war noch lang. Zunächst hieß es die
Passhöhe von Maloja zu ersteigen. Sie ließ uns manchen Tropfen Schweiß
vergießen. Wir waren so erhitzt davon, dass wir nicht wagten, in dem Wirtshaus uns durch einen Veltliner
zu erfrischen. Indes konnten wir doch nicht allen Lockungen widerstehen, als wir
weiter durch das Dorf schritten. Das neue Restaurant, aus Pietät
gegen das Haus, auf welchem es steht, Osteria Vechia genannt,
war soeben beendet. Wir traten in die sehr komfortabel eingerichteten Räume. Ein Glass Wermut erquickte uns!! Der gewöhnliche
Weg von Maloja hierher wollte uns zwar nicht recht behagen, da wir
heute schon so viel Schöneres genossen hatten. Indes kürzten wir ihn
uns ein wenig dadurch, dass wir alte Reste der früheren Römerstrasse
neben der heutigen Chaussee aufsuchten. An zwei Stellen steigt sie links
die Höhe hinan, wo sonst der Weg notwendig unmittelbar zwischen
Felsen und See hingeführt hätte. Gegen sechs Uhr waren wir wieder im Hotel.
Unterdes haben wir noch eine andere, wenngleich nicht so genussreiche Partie gemacht. Mit Familie, d.h. Frau C., Wilhelm und Margarethe fuhr
ich am Sonntag auf den Berninapass. Ein besonders schöner Blick tut sich unterwegs gegen die Bernina über den
Morteratschgletscher auf. Ich finde diesen Punkt der Strasse viel schöner, als das gewöhnlich besuchte Morteratsch-Hotel. Von dem Berninahospiz, wo es sehr rau war, gingen wir (die Frauenzimmer ritten auf Eseln) zu Alp Grüm. Man hat von dort einen sehr schönen, weiten Blick in das Tal von Poschiavo. Man sieht viel weiter und tiefer, als bei Maloja. Einen sehr schönen Kontrast zu dem bewaldeten Thale, wo schon Fruchtfelder zu sehen sind, und zu dem blauen See drunten bildet das blendende Weiß des Palügletschers, der in ziemlicher Nähe und fast untadeliger Reinheit am Berge hängt. Von Ponteresina aus ist es gewiss eine sehr lohnende Tour, die fünfstündige Fahrt von hier aus aber hat doch zu viel Ermüdendes.

Zurückgekehrt von einer einsamen Bootsfahrt auf dem Bodensee will ich die abendliche Stunde noch benutzen, um hier meine Reise dieses Jahres zu beenden. Ich bin ohne dies gar zu selten in diesem Sommer dazu gekommen, aufzuschreiben, was ich erlebt hatte. Vielleicht war es auch das Aufschreiben nicht wert. In Sils gab es zum Schluss recht viele trübe, zum Teil sogar Regentage. Auch die Gesellschaft, die ich im Hotel fand, war nicht außerordentlich und wird wenig dauernde Eindrücke zurücklassen. Nur bei Tische war ich in den letzten Tagen mit einer Veränderung recht zufrieden. Der Fortgang von Kreilsheims und Warburgs, von denen wir erstere hier bereits wieder getroffen haben, erlöste mich endlich von dem fast undurchbrechbaren Kreise von Frauenzimmern, zwischen welchen ich saß.
Ich erhielt dafür die interessante Nachbarschaft des Prof. Trietschke aus Berlin, der einen sehr guten Eindruck auf mich machte. Er ist ein liebenswürdiger Mensch, hat Augen für Alles und was er spricht hat Hand und Fuß. Leider war der Verkehr mit ihm ganz außerordentlich dadurch erschwert, dass er ganz taub ist. Nur von seiner Frau kann er geläufig die Worte am Munde lesen. Mir gegenüber saß Prof. Bona Meier aus Bonn mit seiner Familie. Ich habe sie etwas näher kennen lernen, doch auch nur so, dass die alltäglichsten Dinge von uns besprochen wurden. Es war demnach kein Grund vorhanden, dass mir dieses Jahr der Abschied von Sils hätte schwer werden sollen.
Unsere Zeit, das heißt sechs Wochen Aufenthalt in Sils, war schon vor einigen Tagen abgelaufen, der erste Schnee fast bis in das Tal herunter war gefallen, das Alles ließ mich wohlgemut den Koffer packen, und so ging es gestern an einem wunderschönen Morgen über den Julier. In meine Stimmung hatte sich allmählich Etwas von der Morosität des vorigen Jahres eingeschlichen, ich weiß nicht, wie es kam. Der klare Sonnenschein des jungen Tages aber hellte allmählich auch diese Wolken bei mir auf. Wir hatten einen Wagen aus dem Hotel in Sils, und kamen deshalb nicht allzu schnell vorwärts; aber immer noch zeitig genug, um in Tiefenkasten im Hotel Julier ein kräftiges und gutes Mittagessen einzunehmen. Ich hatte mir schon länger vorgenommen, bei der Rückreise noch eine der Schönheiten Graubündens anzusehen. Erst gedachte ich dem Wagen voraus über den Albula zu gehen. Schlechtes Wetter aber und rückständige Pflanzensendungen nach Hause und Bremen hatten mich zurückgehalten. Nun wollte ich mir wenigstens den Schynpass nicht entgehen lassen.
Gegen drei Uhr machte ich mich auf den Weg nach Thusis. Mit großem Genuss verfolgte ich die kunstreich angelegte Schynstrasse, und freute mich der herrlichen Blicke auf das wunderschöne Tal und den in der Tiefe brausenden, weisslich-grünen Rhein. Ich brauchte nicht allein zu gehen. Ein Schweizer, welcher aus dem Engadin kam, wo er geheut hatte, bot mir Gesellschaft und Unterhaltung. Wir gingen mit einander fast bis Thusis und sprachen über Mancherlei, auch über religiöse Fragen.
Bei meiner Ankunft in Thusis war mir zwar schon manches Schweißlein entronnen und die Sehnsucht nach leiblicher Erquickung groß. Indes in Thusis gewesen zu sein, und die Via Mala nicht gesehen zu haben, wäre Torheit. Ich ging also zum zweiten Male in dieses großartige Denkmal wirklicher Kraft und technischer Leistung. Noch mehr als voriges Jahr imponierten mir die steil abfallenden 300 - 400 Fuß hohen Felswände, an denen sich die eingesprengte Strasse hinwindet. Sie hat fast die gleiche Höhe noch unter sich, und befindet sich an einzelnen Stellen so direkt über dem brausenden Bergwasser, dass man sich völlig über die steinerne Brüstung legen muss, um den weißen Schaum des grünlichen Wassers zu sehen. Sein Tosen dringt an einzelnen Stellen herauf, als käme es aus weiter Ferne. Ich konnte den Weg nicht allzu weit hinein verfolgen, da um sieben Uhr die Post abging, die mich noch am Abend nach Chur bringen sollte. Allzu eilig für die mannigfachen schönen Blicke des Rückwegs musste ich in den Ort zurückgehen. Ich kam indes noch zeitiger an, als nötig war, und konnte mich also für die dreistündige Fahrt stärken. Bald fand sich auch Gesellschaft. Zwei Studenten aus Berlin und Wien kamen mit mir in denselben Beiwagen. Wir haben uns dann die Zeit bis zehn Uhr durch mancherlei Reden vortrefflich vertrieben.
Heute Morgen führte uns der Zug zeitig weiter. Nur der unangenehmen Bummelei auf den Schweizer Bahnen ist es zuzuschreiben, dass wir erst ein Uhr hier ankamen. Das Inselhotel
in Konstanz mit seinen angenehmen Räumen nahm uns liebreich auf und bietet an Erquickung Alles, was man nur wünschen kann. Es ist groß genug, um auch an einem Regentage wie er heute war, die Glieder nicht ganz rosten zu lassen. Im schlimmsten Falle muss der Kreuzgang als Spazierweg herhalten. Heute aber habe ich ihn noch nicht gebraucht. Am Abend lichtete sich das Gewölk und ich konnte noch einen Gang durch die Stadt unternehmen. Später setzte ich die Bewegung auf der reizend gelegenen Veranda gegen den See hin in Begleitung von Frau Konsul fort. Morgen bleiben wir hier, hoffentlich nicht allzu sehr geplagt von den sehr redseligen Kreilsheims. Sie haben mich schon heute Abend auf den See hinaus getrieben. Von hier aus soll es dann im schnellen Schritt nach Hause gehen.

Der wechselvolle Reiz der Reise ist vorüber; des stetigen Landlebens angenehme Stille ist an seine Stelle getreten. Ich bin mit dem Wechsel ganz zufrieden. War doch von Konstanz bis hierher die dreitägige Fahrt ein beständiges Durcheinander verschiedener Bewegungen. Unser Weg war der alte. Zu meiner Freude machten wir in Heidelberg und Köln Stationen. Ich konnte es nicht lassen, in der alten Musenstadt am Neckar das mir nun schon wohlbekannte Schloss zu besuchen. Auch diesmal konnte ich weder zweifeln, was man mit größerem Genuss betrachten muss: die Aussicht von der Terrasse auf Stadt, Fluss und Tal; oder die stille Größe der Ruinen im Inneren des Hofes. Ein Gefühl, welches dem der Andacht nahe kommt, ergriff mich im Anschauen dieser Menschenarbeit. Welche Mannigfaltigkeit, und welche Harmonie, besonders in dem Flügel des Schlosses, welcher sich, der Stadt abgewandt, an den Berg lehnt. Diesmal sah ich auch eine der Merkwürdigkeiten des Schlosses: das "Grosse Fass". Es ist wirklich eine stattliche Vorratskammer. Alle Studenten Heidelbergs, es werden nicht viel weniger als 1.000 sein, könnten täglich je ein Liter daraus trinken, und doch würde der reiche Born für sie zwei Semester lang fließen.
In Köln fand ich einen nicht geringeren Genuss. Den kann dort natürlich nur der Dom bringen. Ich habe auf seiner Höhe gestanden, und von dort das Tiefland überschaut. Es war für mich gewissermaßen eine Nachkur für den Sommeraufenthalt mit seinen Bergen, als ich die 700 Stufen im Dom hinaufstieg. Wie anders aber war der Genuss. Auf die Berge steigt man, um in die Ferne zu sehen. Hier war das, was in der Nähe zu sehen war, weit schöner, als der Blick über die große Stadt und in die Felder und Wiesen, welche sich bis zum Horizonte ausdehnten. Der ganze Bau ist ein herrliches Zeugnis für deutsche Arbeit und deutschen Fleiß. Nicht die kolossalen Dimensionen allein lehren das. Mehr noch bewunderte ich die Sorgfalt bis ins Kleinste hinein, mit der alle die gotischen Zierrate ausgemeißelt sind. Das Werk ist jetzt beendet, wie man sagt. Und doch sah ich es bisher noch nie, ohne dass an irgendeiner Stelle ein Gerüst gehängt hätte. Das ist kein Wunder. Der Sandstein, vielleicht das einzige Material, welche eine so detaillierte Ausführung verträgt, leidet sehr unter den Einflüssen der Witterung. Schon an dem Bau des letzten Jahrzehntes konnte man ihren nagenden Zahn erkennen. Augenblicklich war man beschäftigt das Dach mit Blei zu decken. Ich erhielt bei dieser Gelegenheit einen Einblick in die Werkstätte des Dombaues, und war verwundert, zu sehen, dass der Dachmeister nicht in Stein weiter über das Dach gebaut ist, sondern auf dicken, eisernen Trägern ruht. So soll dem Gewölbe aus Tuffstein die dem Auge so zierliche Last noch erleichtert werden. Natürlich war ich auch im Innern des größten deutschen Gotteshauses. Der Eindruck verliert, so oft man ihn auch empfängt, Nichts von dem Großartigen und Ergreifenden, mit welchem der zum ersten Male Eintretende förmlich überwältigt wird. Nur ungern sagte ich dem edlen Tempel Lebewohl, hoffentlich auf Wiedersehen. Die wenigen Stunden, die mir in Köln noch blieben, benutzte ich, um mit Wilhelm die Gemälde- und Altertumssammlung anzusehen. Es ist ein überaus reiches Museum. Antike römischen Büsten und wundervolle Glassgemälde waren das Anziehenste für mich.

Was "ländliche Ruhe" zu bedeuten hat, habe ich vielleicht noch nie so empfunden, wie gerade jetzt. Ich glaube eine Erholungsreise gemacht zu haben, und es waren doch im Grunde nur einige Wochen bunten Lebens und mannigfacher körperlicher Anstrengung gewesen. Das ist jetzt ganz anders. Wir wohnen in einem einsam gelegenen Hause. Der nächste Nachbar, der Besitzer einer jener idyllischen Bauernhöfe, woran diese Gegend so reich ist, liegt uns in Entfernung von etwa zehn Minuten gegenüber. Delmenhorst ist der nächste Ort, zu dem wir auch gerechnet werden. Ich muss aber bis zur Kirche oder dem Bahnhof immer über eine halbe Stunde gehen. Der Weg ist indes ganz angenehm. Er führt größtenteils mitten durch fremdliche Gartengrundstücke. Hier haben sich Kapitäne und andere Arbeitsmüde, die aber noch nicht lebensmüde sind, zur Ruhe gesetzt. Unser Haus liegt auf einer kleinen Anhöhe, welche, am Ende der Stadt beginnend, sich zwischen den beiden Chausseen nach Oldenburg und Wildeshausen hinzieht. Von Zeit zu Zeit liegt auf dieser geringen Bodenerhebung ein kleines Gehölz, meist aus Eichen und Buchen bestehend. Sie unterbrechen angenehm die Einförmigkeit der Landschaft. Der magere Boden hat rings herum einst nur Heide getragen; jetzt hat aber die Kultur jene Idylle vergangener Zeiten verdrängt. Nur kurze Strukturen der sanftroten Erica erinnern noch an die Vergangenheit. Die tiefer gelegenen Landstrecken bilden einen frischen Kontrast zu dem einförmigen Grau des Höhenzugs. Es sind da feuchte Wiesen, ja an einzelnen Stellen lässt der moorige Grund keines Menschen Fuß das saftige Grün betreten. Dieser Teil der Landschaft ist am interessantesten für mich, auch schmückt er sich noch mit den schönsten Zierraten: blaue Gentianen lassen sich dort mit der roten Erica und mancherlei Sumpfpflanzen zu niedlichem Strauße binden.
Unser Haus liegt auf dem Höhenzuge, und schaut von da weit hinüber über Felder, Wiesen und Gehöfte in das Land. Selbst Bremen, welches doch drei Stunden weit entfernt ist, können wir bei etwas klarem Wetter sehen. Das Land rings herum gehört zu Oldenburg, das entferntere zu Hannover. Der Blick in die unmittelbarste Nähe ist noch nicht so anziehend, wie es nach zehn Jahren sein wird. Da sind sorgsam angelegte Pflanzungen von seltenen Bäumen, meist Nadelholz. Das Ganze macht schon jetzt, im Entstehen, den Eindruck einer prächtigen, kunstgärtnerischen Anlage. Sie wird eine vollkommene Wirkung erst dann erzielen, wenn sie im Laufe der Jahre ein Ganzes geworden ist mit dem Gehölz, in dessen Schatten spendenden Rande unser Wohnhaus erbaut ist. Wir schauen aus den Zimmern recht ins volle Grün. Hochstämmige Eichen und Buchen bilden auf der Rückseite des Hauses einen sehr freundlichen Park. Das reichliche Unterholz, mit Schlinggewächsen romantisch durchwachsen, lässt seine Ausdehnung größer erscheinen, als sie in Wahrheit ist. Auf mannigfach geschlungenen Wegen lässt sich ein hübscher Spaziergang machen, den ich alle Tage wenigsten einmal genieße.
Die Einrichtung des kleinen Landsitzes ist sehr geschmackvoll und kostbar. Der Bau ist etwas mittelalterlich gehalten; rote Ziegel geben mit Sandstein eine recht lebendige Farbenwirkung gegen das Grün der Umgebung. Im Innern herrscht eine ruhige, behagliche Stimmung. Möbel von Eichenholz, altdeutsche Gesimse und Büffets machen den Eindruck, als ob schon lange, lange Zeit hier wohnliche Räume wären. Durch Nichts wird man erinnert, dass dies Haus nur für einen Sommeraufenthalt bestimmt ist. Höchstens das Fehlen der Öfen kann darauf führen; dieselben sind aber durch mächtige Marmorkamine ersetzt. Sie erhöhen noch den gemütlichen Eindruck des Ganzen. Mein Gelass ist übrigens ziemlich unscheinbar, was ich jedoch wenig empfinde, da ich mich fast den ganzen Tag über in den anderen Zimmern des Hauses aufhalte. So komme ich hier herauf fast nur zum Schlafen. Der Umstand, dass ich übrigens nur vier Wochen hier sein werde, hat ohne Zweifel bewirkt, dass man weiter keine Vorkehrungen für mich getroffen hat. Der Verkehr mit der Familie ist hier natürlich etwas intimer geworden als in Bremen oder gar auf der Reise.
Fast den ganzen Tag über bin ich mit Mutter und Kind zusammen. Am Morgen nehmen wir alle zu gleicher Zeit das Frühstück, nach dessen Beendung ich mit Wilhelm an die Arbeit gehe, während Herr Konsul zur Bahn reitet, um seinen Geschäften in Bremen nachzugehen. Er kehrt erst nachmittags gegen sechs Uhr zurück. Seine Abwesenheit führt aber zu keiner Unregelmäßigkeit im täglichen Haushalte. Wir frühstücken halb elf Uhr zum zweiten Male und haben dann noch bis zwölf Uhr Unterricht. Kurze Zeit darauf sieht man mich mit großer Regelmäßigkeit durch die Fluren streifen. Ich habe in den Tagen bisher die Umgebung fast allseitig kennen gelernt. Gegen zwei Uhr bin ich zurück und finde mich mit Mutter und Sohn zum Mittagessen zusammen. Wir sind recht heiter dabei.
Um den Schmaus zu verdauen, bedürfen wir Alle einer gewissen Ruhe. Ich finde sie auf der Veranda vor dem Hause oder unter den schattigen Bäumen in abgeschiedener Zurückgezogenheit. Erst gegen halb fünf Uhr finden wir uns wieder um den Kaffeetisch zusammen, um bald darauf noch zwei Stunden an die Arbeit zu gehen. Nach derselben reicht das Tageslicht jetzt gerade noch hin, das ich einen kleinen Spaziergang mache, oder mit Wilhelm jagend das Gehölz durchstreife. Der Abend sieht uns dann, wie der Morgen, alle vereint: zuerst in einem der Wohnzimmer, wo wir Landbewohner die Neuigkeiten aus Bremen zu hören bekommen, und vielleicht die von Herrn Konsul mitgebrachten Zeitungen lesen. Das Abendessen beschließt sodann unser gemeinsames Tagewerk.
Meine Stellung zu Herr u. Frau Albers ist ganz vertraulich, aber fern von jeder Intimität. Mit Frau Konsul schien es, als ob ich auch zu letzterer käme. Ich habe mir indes selbst sehr bald in dieser Hinsicht große Beschränkungen auferlegt. Wäre unsere Aussprache offener geworden, so hätten wir uns gegenseitig wohl oft Unannehmlichkeiten sagen müssen. Ich wenigstens hätte nicht gut vermeiden können, ihr Vorstellungen zu machen über die verkehrte Art der Erziehung. Da solche Nichts nützen, wo ich es versuchte, und nur ein Übel durch ein schlimmeres abgelöst wurde, so habe ich es zu unterlassen für besser gefunden. Anderseits sagt mir der gewöhnliche Unterhaltungston gar nicht zu, der den Frauen der Gesellschaftskreise nun einmal in Fleisch und Blut übergegangen zu sein scheint. Ich meinerseits mag mich nicht unterhalten, lediglich war meine Zunge in Bewegung zu halten. Ein Gespräch soll entweder belehren, oder von wohltuendem Einfluss auf das Gefühl sein. Beides fand ich hier nicht, und so habe ich vielleicht öfter geschwiegen, oder bin zurückhaltender gewesen, als einem näheren Verkehre förderlich war. Übrigens scheint auch anderen Menschen der Verkehr mit der Familie nicht ganz leicht zu sein. Es verkehrt im Hause
niemand, der wirklich intim wäre. Selbst mit den nächsten Verwandten steht man auf einem so gemessenen Fuße, wie ich etwa mit Bekannten, die ich noch nicht lange kenne.
Die Liebe des Jungen habe ich nicht gewinnen könne, so oft ich mir darum Mühe gab. Einmal schien es, als ob er sich vertraulicher mir anschlösse. Aber da war es, glaube ich, eine mütterliche Eifersucht, die ihn zurückzog. Ich habe natürlich den Verzärtelungen des Jungen entgegengearbeitet, der unter dem Weibereinfluss alle Energie verliert. Da ihm nun doch Alles nachgesehen wird, kein Wunsch versagt, meine Pflicht mir aber gebot, ihm zuweilen zu zeigen, dass es ein "muss" im Leben gibt, so wird sich auf diese Weise wohl erklären lassen, warum ich auf so wenig Anhänglichkeit seinerseits werde hoffen dürfen.

Mir sagt das Landleben hier jetzt wenig zu, ich weiß nicht, worin ich den Grund dafür suchen soll; indes geradezu Furcht habe ich vor dem Gedanken, dass mein bisheriges Leben in der Stadt mir die Freude an der simplicitas vitae rusticae genommen hat. So suche ich denn alle möglichen Gründe, die mir gerade hier den Landaufenthalt verleiden könnten. Der Mangel für mich, dass ich eigentlich hier gar
niemand habe, mit dem ich intimer verkehren könnte. Die anderen sind doch wenigsten durch das Familienband an einander geknüpft, so lose es auch sie zum größten Teile zusammenfesselt. Ich aber bin mehr oder weniger ein überflüssiges Rad am Wagen. So mache ich denn allein meine mittäglichen Streiferein durch Felder, Heide und Wald. Vereinsamt sitze ich nach Tische unter den Buchen des Waldes und finde oft neben der Lektüre von Humboldts Reisen keine andere Unterhaltung, als den Eichhörnchen zuzusehen, welche über mir in den Zweigen spielen. Die Dämmerstunde aber, die ich sonst so gern in lustiger Gesellschaft oder wenigstens bei anregender Unterhaltung zubrachte, sie sieht mich noch auf einem einsamen Spaziergange, oder am hinteren Ausgang des Wäldchens, wo der Blick sich in einem stillen Wiesentälchen zwischen Haselsträuchern verliert. Da müssen oft die alten Lieder, freilich einförmig und eintönig, einen Abglanz von der alten Lust heraufbeschwören. So geht der Tag dahin, so kommt er wieder.
Bei diesem musterhaften Einerlei war mir eine Abwechslung am gestrigen Sonntage ein willkommener Genuss. Martin kam heraus, und ich fuhr mit ihm nach Hude, einem Dorfe zwischen hier und Oldenburg. Lange schon hatte man mir die Schönheit der Ruinen gerühmt, die dort von der Vergangenheit eines alten Klosters zeugen. Wir fanden denn auch recht ausgedehnte Überreste einer alten Klosterkirche. Aus roten Ziegelsteinen ist das Gebäude im Stile der alten franz. Zeit errichtet. Das Kloster zu Hude ist eins der ersten Zisterzienser-Klöster in Deutschland gewesen. Seine Gründung geht also wohl bis ins 13. Jahrhundert zurück. Jetzt steht nur noch ein verhältnismäßig kleiner Teil der Säulen und Bogen. Die Dimensionen aber lassen auf ein sehr imposantes Bauwerk schließen. Diese Steinmassen werden noch lange von vergangenen Zeiten reden. Dichter Efeu bedeckt das Gemäuer bis in die höchste Gipfel, welche kaum von den schlanken Tannen überragt werden. Das Material scheint ebenfalls nicht vom schlechtesten gewesen zu sein. Der Mörtel kittet die Backsteine aneinander, dass man in den massigen Klumpen der Felsblöcke als ein Conglomerat vermuten sollte. Freilich wird davon erzählt, dass man den Kalk einst mit Milch statt mit Wasser aufgelöst hatte. Wenn es nicht bloß boshafte Erfindung ist, so haben einst die Mönche die fetten Bauern dabei stark bluten lassen.
Von Hude unternahmen wir eine Fußpartie durch den Hasbruch, einen Wald von ziemlicher Ausdehnung. Mächtige Eichen führten auch hier unsere Gedanken in die Vergangenheit zurück. Leider wurde der Genuss mir etwas beeinträchtigt. Mein Hauskreuz, das Magenübel, macht sich auf dem Wege besonders fühlbar. Das gibt immer einen bösen Rückschlag auf die Stimmung; ich war darum froh in Martins Gesellschaft zu sein, dessen jugendliche Lebendigkeit mir über trübe Gedanken hinweghalf.

Vor wenigen Tagen erhielt ich einen Brief, der meine Gedanken augenblicklich noch sehr lebhaft beschäftigt, da er, wie es scheint, für meine Zukunft große Bedeutung haben wird. Der alte Studienbekannte Ernst Dürbig, jetzt Refendar in Plauen i. V., fragt bei mir an, ob ich nicht geneigt wäre, im nächsten Winter bei seinem Vater eine Hilfspredigerstelle anzunehmen. Das kommt in einer Zeit, wo ich mit Besorgnis der nächsten Zukunft entgegensehe, weil in dem Predigerseminar zu Leipzig kaum der nötigste Unterhalt gewährt wird. Meine Zusage, erfolgte umso lieber, als ich Dürbigs Haus als ein sehr gebildetes und wohlhabendes alle Zeit habe rühmen hören. Mit den Arbeiten im Seminar wird sich die Stellung natürlich vertragen müssen, das habe ich meiner Zustimmung hinzugefügt. Wenn dies sich einrichten lässt, dann ist nach meinem Dafürhalten kein Grund vorhanden, mich nicht über diese Wendung der Dinge zu freuen. Zwar müssen Gelüste fallen, die mir nach Vorlesungen an der Universität kamen. Auch muss ich die praktische Arbeit fallen lassen, der ich mich im Anschluss an den Jünglingsverein in Leipzig hingeben wollte. Aber dafür in vielleicht sehr angenehmer Weise in das praktische Amt eingeführt zu werden, ist ein wohl nicht zu verachtender Tausch.
Den Vater habe ich erst nach meiner Zustimmung in Kenntnis gesetzt. Er wird sich hoffentlich mit mir freuen, wenngleich er nach seinen Andeutungen mir andere Pläne nahe legen zu wollen schien. Ich sollte auf die Pfarrstelle in Zeithain reflektieren, eine mir durchaus nicht sympathische Aussicht. Denn dort würde ich ein Amt antreten, in dem ich mindestens Jahre lang tätig zu sein gedächte. Noch aber ist die Beweglichkeit der Jugend bei mir zu stark, als dass ich mich freiwillig so in Fesseln schlagen ließ. Auch ist mir noch nicht so sehr die Romantik des Lebens geschwunden, dass ich die besten Jahre meines Lebens in der langweiligen Einöde verbringen sollte. Hierin kann freilich bald ein Umschwung der Ansichten eintreten. Wäre es nicht genug, wenn ich nur eine rechtschaffene Arbeit fände? Könnte Gott mich nicht gerade Wege führen wollen, wo ich mich besser selbst zu verleugnen lernte, als ich es bisher kann? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das liebe Ich es ist, welches gegen eine, wie es mir jetzt scheint, freudeleere Arbeit protestiert. Aber ich weiß auch nicht, ob Gott mich gerade dazu haben will. Ich glaubte vielmehr, neulich recht lebhaft Gottes hütende Hand zu erkennen, als Dürbigs Brief plötzlich meine Besorgnisse unnötig machte. So hoffe ich denn, dass ich keinem Jonas gleichen werde und Gottes Willen mit mir mich entgegensetzen. Aber eben so weit möchte ich entfernt sein von einem selbst gewählten Martyrium. Habe ich doch in letzter Zeit erst erfahren, wie schwer oder unerreichbar seine Krone für mich ist. Es fiel mir recht schwer, Vielem zu entsagen.
Meine Stimmung war durch die hiesigen Verhältnisse und mehr noch vielleicht durch mein Magenübel so gedrückt, dass es mir vorkam, als wollte ich am inwendigsten Menschen anfangen zu altern. Der neue Aufschwung in meinen Gedanken aber hat sogar mein körperliches Befinden merklich gehoben. Auch scheinen mir die noch übrigen zwei Wochen hier gar nicht so unverträglich, wie vorher. So wird mein ganzes Denken und Empfinden von einer Stimmung getragen. Es ist schlimm, das ich gegen solche Schwächen nicht kämpfen kann. Dass ich mich ihnen aber entziehen kann, bessert zwar prinzipiell an der Sache Nichts, hilft aber mir und Anderen über das Unangenehme hinweg, was sie nötig im Gefolge haben.

Zu meiner großen Befriedigung sind wir noch die letzte Woche meines Hierseins in die Stadt übergesiedelt. Es war auf dem Lande zu unfreundlich. Fast alle Tage wollte der Nebel von Morgen bis zum Abend sich nicht lichten. Dazu fingen die Abende an lang zu werden – Alles nicht geeignet, den Stadtkindern Freude am Landleben zu geben. Hier kann ich nun in einiger Ruhe an das Weggehen denken, und meine Vorbereitungen treffen. Von den nötigen Abschiedsbesuchen habe ich heute schon einige gemacht. Es war heute Bußtag hier, und so hatte ich Zeit, und konnte zugleich hoffen die Herren, welche sonst im Geschäfte sind, zu treffen. Wenn man einen Ort verlässt, merkt man erst, wie viele Verbindlichkeiten man allmählich da eingegangen ist. So muss ich die Geschwister der Familie Albers besuchen, eine ziemliche Anzahl der Pastoren, die Familie Uelzen, Meier und Hogermann.
Heute habe ich noch einige Anregende Stunden verlebt. Es fand eine Versammlung für Innere Mission auf dem Schützenhofe statt. Es ist eigentümlich und meinen früheren Anschauungen gar nicht konform, wie man sich bei religiösen Versammlungen hier über alle Form hinweg setzt. Der Schützenhof ist sonst Volksgarten, der Saal, wo wir saßen, dient als Tanzlokal für ein sehr gemischtes Publikum. Für solche Leute, welche besonders der Fürsorge der Inneren Mission bedürfen, wurde also am Schauplatze ihrer Orgien eine Beratung gehalten. Das stört aber freilich hier Niemand. Und das ist gut. Es fände sich in der ganzen Stadt schwerlich ein Lokal, geeignet 500 - 1.000 Menschen zu fassen, wenn man wählerisch dabei umgehen wollte. Drei Vorträge wurden gehalten. Einer der bremischen Landpastoren hielt eine Art Predigt mit Bezug auf die innere Mission. Darauf sprach nach einem kurzen Gesange Pastor
Volkmann über die Stadtmission. Mit der Forderung nach numerischer Erweiterung dieses Arbeitsgebiets verband er einen Bericht über die bisherige Arbeit der Stadtmissionare in Bremen. Auf eine doppelte Errungenschaft kann dieser Zweig der religiösen Fürsorge sicherlich stolz sein. Innerhalb eines Jahrzehntes sind auf Anregung dieser Arbeiter in Bremen zwei neue Kirchen entstanden:
Funckes u. Jacletts Friedenskirche und die Jacobi-Kirche von
Volkmann. Auch in Hinsicht auf die freie Beweglichkeit der Stadtmissionare an allen Orten und auf die leichtere Vertraulichkeit mit den Leuten wies der Redner mit Vorteil für das Interesse an der Sache hin. Zum Schluss sprach Funcke über die religiösen Umstände Englands, speziell über die sog. Heilsarmee.
Ich konnte nur etwa die Hälfte hören, da ich Herrn Meier versprochen hatte, ihn zu einer bestimmten Zeit für das Konzert im Dom abzuholen. Es müssen wunderliche Zustände in England sein. Nach Allem, was ich bisher davon erfahren, besitzt man dort kein feines Gefühl für das religiöse Leben der Menschen. Man will durch künstlich hervorgerufene Reizmittel erzwingen, was bei ruhiger Überlegung nicht geschehen würde. Das mag bei Einzelnen erwecken, für die Dauer können aber solche Mittel nicht wirken. Über alle unsere Begriffe geht der Apparat, welchen jene neue Bewegung zur Verwendung bringt. Wie Funcke sagte, werden wöchentlich in England 5.000 Versammlungen der Heilsarmee abgehalten, welche durchgängig sehr stark besucht sein sollen.

Wie wunderbar und oft ganz anders, als wir denken und wollen, unsere Lebenswege geführt werden, habe ich seit meinem Weggange aus Bremen hier erfahren. Ich bin nicht nur zur Unterstützung des Pastor Dürbig hierher gekommen, wie ich dachte, sondern um ihn seiner Gemeinde provisorisch ganz zu ersetzen. Er starb an demselben Tag (9. Oktober), wo ich in sein Haus trat. So konnte ich nur an seinem Sterbebette stehen. Es waren trübe Stunden, die mich aber mit der Familie des Verstorbenen recht innig zusammengeführt haben. Ich war Anfangs ganz allein bei der Mutter; die Kinder mussten erst aus Plauen herbeigerufen werden, da sie ohne Ahnung von dem nahen Tode am Abend vorher den Vater verlassen hatten. Es war in Pastor Dürbig ein edler Mann, reich an Gaben des Geistes und des Herzens, verschieden. Das bewiesen die Worte, die bei seinem Begräbnis gesprochen wurden und mehr noch die Beweise der Liebe und Anhänglichkeit, welche eine außerordentlich große Menschenmenge darbrachte.
Nun wohne ich hier, in der ländlich-einfachen, aber mir schon ganz heimischen Pfarrei mit Frau Pastor Dürbig und ihrer Tochter; beide, soweit ich sie bis jetzt kenne, stille und religiös-ernste Naturen. Mir ist für die nächste Zeit der größere Teil des Amtes übertragen. Nur Taufen und Abendmahl werden von P. Kronfeld in Gautzsch gehalten. Da komme ich recht in das praktische Leben meines Berufs hinein. Zu meiner Freude aber fühle ich mich recht wohl dabei. Die Stille im Hause und in der ganzen Umgebung sagt mir so außerordentlich zu, dass ich augenblicklich wünsche, es möchte länger so bleiben. Das wird aber nur bis Weihnachten der Fall sein. Da gedenkt Frau Pastor D. Städteln provisorisch zu verlassen, und da meine Arbeit und mein Aufenthalt hier sich nur auf die persönliche Beziehung zwischen uns stützt, so habe ich keinen Grund, länger zu bleiben. Wohl aber habe ich Veranlassung, zur Vorbereitung auf das Examen (Osten 83) mich ganz den theologischen Arbeiten hinzugeben. Ich werde darum, so Gott will, an Neujahr den Eintritt in das Prediger-Seminar, der de jure schon 1. Oktober geschehen war, nachholen. Am 24. Oktober feierte ich mit Teichgräber und A. in Leipzig Freund Hackers Hochzeit mit Frida Seemann. Er hat sein niedliches Frauchen nach Tannenberg im Erzgebirge heimgeführt.

Allmählich habe ich mich ganz in den Pfarrstand eingearbeitet. Je länger ich ihn übe, um so lieber wird er mir, sodass mir ein Interregnum in Leipzig von Weihnachten an gar nicht recht behagen wird. Doch wird es mir auch dort hoffentlich nicht schwer werden, mich zu akklimatisieren. Hier macht mir jetzt nur eins noch Sorge: Meine wechselnde Gemütsstimmung. Bald bin ich hoffnungsfroh und voll weitgehender Pläne. Dann aber macht sich plötzlich mein Magenleiden mit seinem Nervenaffektionen fühlbar, und da werde ich zuweilen recht Kleinlaut. Selbst in den Stunden amtlicher Arbeit überkommt mich dann plötzlich eine Schwäche.
In den vergangenen Tagen habe ich einige Zeit recht merkwürdige Erwartungen mit mir herumgetragen, über deren Ausdehnung ich mir selbst erst recht bewusst wurde, als sie allem Anschein nach aufhörten, Grund zu haben. Aus der hiesigen Gemeinde wurden mir indirekt und direkt verschiedene Stimmen laut, dass man mich als Pfarrer hier zubehalten wünsche. Ich habe natürlich Nichts dazu und nichts dagegen getan, merkte aber doch, dass die Gedanken daran sich auch bei mir festgesetzt hatten. Jetzt ist der Gedanke, wie ich glaube, in der Gemeinde und auch bei mir überwunden. Ich denke: wie Gott mich führt, so will ich gehen. Wenn er mir Gesundheit gibt, soll mich das nächste Jahr womöglich ganz in Leipzig bei Spezialstudien über Mission sehen – natürlich nach absolviertem Examen. Ob ich dann noch dem Vaterlande untreu werde und die alten ägyptischen Pläne verwirkliche, bleibt Gottes Führung überlassen.
Vor acht Tagen hat mich der Vater hier besucht. Ich habe in einigen ruhigen Stunden mit ihm über unser leider mannigfach traurige Familienlage gesprochen. Es ist doch gut, wenn wir mit den Eltern das Schwere gemeinsam tragen. Bei Georg ist immer noch keine Aussicht auf eine nur befriedigende Lösung seiner zerrütteten Verhältnisse.

Du gehst von einer Station zur andern, sagte mir der Vater bei dem letzten Abschiede von dem Elternhause. So ist es. Wann werde ich eine Ruhe finden? Darüber kann ich heute ebenso wenig sagen, wie vor einem Jahre. Nur dass vielleicht ein Gedanke hierbei stärker in den letzten Zeiten in den Vordergrund getreten ist, der, dass ich vielleicht bald einmal werde zu einer andern Ruhe gerufen werde, als die ich hier suche. Mein körperliches Wohlbefinden hat sich im letzten Jahre sehr verschlechtert. Das alte Magenübel will nicht zurückgehen, hat vielmehr noch einen andern bösen Freund mitgebracht, nervöse Gereiztheit. Besonders meine Kopfnerven sind oft Tagelang so angegriffen, dass ich nur mit Aufbieten aller Energie bei der Arbeit bleiben kann. Das trübt mir den Blick in die Zukunft sehr und hat auch schon bewirkt, dass ich einen meiner Lieblingsgedanken für die erste Arbeits- und Amtszeit aufgegeben habe. Nicht nach Ägypten oder einer anderen exotischen Pfarrei steht mir mein Sinn, ich werde nun wohl ein biederer sächsischer Landpastor werden, wenn Gott Leben und Gesundheit schenkt.
Um wenigstens noch möglichst Vieles für mein späteres Leben zur inneren Grundlegung zu finden, bin ich endlich hier in das Predigerkollegium eingetreten. Ich befinde mich darin im Ganzen recht wohl, obgleich ich etwas mehr tieferen Gehalt vermutet hatte. Die Arbeiten sind ganz intensiv und lassen noch Raum genug für Privatstudium. Jetzt vor Ostern gilt das der Vorbereitung auf das zweite Examen, welches kurz nach dem Feste in Dresden absolviert werden soll. Nach demselben hoffe ich hier noch ein recht stilles, gesegnetes Jahr zu verleben, wobei ich mich am liebsten in Missionsgeschichte vertiefen möchte. Doch das fügt Gott vielleicht wider meinen Willen anders. Gern werde ich jedenfalls noch eine Zeit lang hier bleiben. Schon deshalb, weil dann Frau Pastor Dürbig mit ihrer Tochter hier in Leipzig wohnen werden. Beide habe ich in der kurzen Zeit meines Zusammenseins mit ihnen sehr schätzen und lieben gelernt. Mit ihnen hier wieder in engerem Verkehr zu treten, ist deshalb meine Hoffnung. Über eine gewisse Einsamkeit, die ich bei dem ungewohnten Garconleben (Junggesellenleben) bisher oft empfunden habe, würde ich dadurch ganz gewiss hinwegkommen. Augenblicklich wohnen sie noch in Städteln, wohin ich zu meiner Erholung bin und wieder einmal gehe oder fahre. In vier Wochen werden sie aber für die Frühjahrsmonate nach Nizza reisen, um ihre Gesundheit wieder herzustellen. Gott gebe es Ihnen.

Auch im Bette sollte ich einmal in diesem Buche schreiben; glücklicher Weise ist es jetzt schon mehr Lager der Langenweile, als der Schmerzen. Seit fast einer Woche liege ich im Stadtkrankenhause, um mich hier von einer schwachen Lungenentzündung kurieren zu lassen. Die Krankheit kam mir recht ungelegen. Ich hatte versprochen, vorigen Sonntag zum letzten Male in Städteln zu predigen, und musste noch am Nachmittag vorher absagen. Leider kann ich nun auch Mutter und Tocher Dürbig vor ihrer Abreise nicht noch einmal sehen. Dieselben reisen ihrer Gesundheit halber in Bälde nach Nizza, von wo sie erst gegen Pfingsten zurückzukehren gedenken. Sie haben sich teilnehmend nach mir erkundigt. Überhaupt darf ich während meiner "Niederlage" nicht über
mangelnde Gesellschaft klagen. Alle meine Bekannten besuchen mich recht oft, um mir die Zeit zu vertreiben. Die Langeweile plagt mich überhaupt hier nur höchst selten. Ich liege in einer Baracke, wo zwar ein besonderes Stübchen mich aufgenommen hat, ich aber von den übrigen Kranken genug höre und sehe, um den ganzen Tag Abwechslung zu haben. Es ist ganz lehrreich für mich, einmal einige Zeit unter Kranken zu leben. Fast Jeder trägt sein Leiden hier anders. Es gibt gewisse Betten, die von unverwüstlichem Humor sprudeln, auch wenn es schlecht geht. Wieder Andere fressen ihr Leiden still in sich hinein. Natürlich ist auch Seufzen und Wimmern kein ganz seltener Gast bei uns. Zum Glück für die ganze Baracke VII, in der ich liege, haben wir eine ganz vorzügliche "Schwester". Es ist eine Albertinerin und geradezu ein Muster in ihrem Beruf. Sie ist während der Woche meines Hierseins nur einmal zwei Stunden ausgegangen, und verlässt sonst die Baracke nie. Dabei legt sie eine Heiterkeit und Lebendigkeit an den Tag, die den Kranken das Schwere leichter macht und ihr selbst.

Schon erinnern mich nur noch leise Stiche beim tiefen Atemholen daran, dass ich eben erst das Krankenbett und Krankenhaus verlassen habe. Gott hat es wider alles Erwarten gnädig mit mir gemacht. Kaum 14 Tage bin ich recht eigentlich arbeitsunfähig gewesen, was nach der ersten Ansicht des Doktors wenigstens die doppelte Zeit dauern sollte. Jetzt bin ich in Begriff, zur Rekonvaleszenz nach Hause zu gehen.
Nur zur Ordnung meiner Verhältnisse halte ich mich noch zwei Tage
in meiner Wohnung auf. Anfangs kam mir beinahe ein Gefühl der Sehnsucht zurück in die Pflege und Ordnung des Krankenhauses an, als ich nun plötzlich wieder in der einsamen Wohnung mir selbst überlassen war. Nun freue ich mich doch, dass es überstanden ist, bin aber nichts desto weniger überall, wohin ich komme, Lobes voll über das vortreffliche Institut, in dem ich die Krankheitstage zugebracht habe. Ich wüsste auch wirklich kaum Etwas daran zu tadeln. Sollte ich, was Gott verhüte, wieder einmal liegen müssen, so werde ich sicher nie in meiner Wohnung bleiben, so lange das Junggesellenleben mich auf die Pflege einer Wirtin anweist.
Selbst in der Familie ist es gar nicht möglich, eine so rationelle Pflege und aufmerksame nützliche Behandlung zu haben. Dazu ist der Kostenpunkt ein unglaublich niedriger. Ich habe, ohne dabei irgend welchen Vorteil zu genießen, täglich 1,25 M. bezahlt. Für
solche, welche von außerhalb Leipzig kommen, betragen die täglichen Kosten 2 Mark. Und dafür hat man Verpflegung, ärztliche Behandlung und Arznei. Man lebt auf diese Weise während der Krankheit billiger als in gesunden Zeiten.
Als ich anfangen konnte, das Bett zu verlassen, habe ich, so weit es möglich war, meine Studien gemacht. Es war ebenso interessant, das Gebaren der einzelnen Kranken zu beobachten, wie in ihrer Behandlung zu lernen. Ich bin bei der allezeit strengen und doch lustigen "Schwester Clara" in die Schule gegangen, habe mir Verbände und praktische Kunstgriffe zeigen lassen und mich an den Anblick schrecklicher Wunden etc. gewöhnt. So habe ich neben der Geduld doch noch ein wenig Anderes gelernt. Die Tage der Krankheit habe mir außerdem noch gezeigt, dass ich hier in Leipzig doch nicht so vereinsamt dastehe, wie es mir in gewissen einsamen Stunden scheinen wollte. Man hat mir von allen Seiten ungemein viel Teilnahme erwiesen. Ledigs, Barths, Tante Heffter, Methes, Frl. Meisels und alle Jugend- und Kollegs-Bekannte haben sich angelegentlich nach meinem Befinden erkundigt und teilen jetzt die Freude über meine rasche Genesung, für die ich Gott alle Tage von neuem dankbar bin. Nun werde ich ungehindert nach Ostern in mein letztes Examen steigen können. Schon habe ich einen Stoss Bücher ausgewählt, den ich morgen packen und mit nach Hause nehmen will. Der rechte Trieb zu vorbereitender Arbeit fehlt mir zwar noch, doch, denke ich, die Zeit des heranrückenden Examens wird ihn bringen. Von den Arbeiten des Prediger-Kollegs während der Ferien bin ich stillschweigend dispensiert worden, obgleich ich natürlich mit einigen Arbeiten im Rückstande bin. So Gott will, kann ich das im neuen Semester nachholen.

Meine äußeren Lebensverhältnisse haben sich wieder einmal etwas verschoben, ohne dass ich indes besondere Empfindungen davon gehabt hätte. Ich war die ganze Osterzeit hindurch als Rekonvaleszent zu Hause, und habe mich da redlich gepflegt, daneben aber nur wenig gearbeitet, was eigentlich in Hinsicht auf das nun bestandene Wahlfähigkeitesexamen in Dresden recht nötig gewesen wäre. Nun, es ist auch ohne dies gegangen. Im Verlauf von acht Tagen, während denen ich mit Nepperwitz (Vogel), Starke, Vetter Baltzer, Teichgräber und noch einem angenehmen Konexaminanten Namens Preuss im "Curländer Haus" wohnte, war die ganze Geschichte vorüber: Montag Mittag Vorstellung, Dienstag schriftlich (de sacrificies), Mittwoch früh mündlich, danach Empfang der Texte für Predigt und Katechese, die am Freitag Abend abgegeben und am Sonnabend gehalten wurden. Die schnelle Aufeinanderfolge der Gegenstände macht das Examen etwas anstrengend; sonst ist es keineswegs eine Kunst, dieses Examen zu bestehen, da von positiven Kenntnissen eigentlich nur große Vertrautheit mit der Bibel verlangt wird. Wir sind trotz der Anstrengung die Woche hindurch recht heiter gewesen und haben wohl in Folge daran viel Vergnügen u. Genuss in diesem letzten Examen gefunden. Ob die verehrlichen Konsistorialräte von unsern Arbeiten den gleichen Eindruck gewonnen haben, weiß ich nicht, da man uns die Resultate des Examens noch nicht mitgeteilt hat.
Eine zweite Veränderung ist die, dass ich meine alte Wohnung auf der Langen Strasse verlassen habe und seit 1. Mai zu Tante Heffter gezogen bin. Kurz vor Ostern starb Stella an einem Brustleiden, das sie schon lange mit sich trug und welches alle Hoffnung auf Genesung ausschloss. Nun fühlte sich die Tante sehr vereinsamt, da auch Arthur nicht bei ihr sein kann. Er arbeitet gegenwärtig in Greifswald, um die Doktorwürde zu erlangen. So erneuerte die Tante den schon früher ausgesprochenen Wunsch, dass ich bei ihr wohnen möchte, dem ich auch recht gern entgegen kam. Ich habe also meinen Umzug nach der Carlstr. 3b bewerkstelligt, und bewohne hier ein freundliches sonniges Zimmer, welches mich teils nach der Strasse, teils in einem hübschen Garten sehen lässt. Ich hoffe hier in angenehmer Ruhe noch Vieles zu arbeiten, besonders über Gegenstände, welche die Mission betreffen und die ich schon lange habe aufschieben müssen.
Gestern, zum Himmelfahrtstage, hatte ich die gewöhnliche Sonntagsarbeit im Kollegium, die Predigt früh in Stötteritz und Abends in der Paulinerkirche. Nach jener ersten in der Heilanstalt zu Stötteritz habe ich beim Frühstück mit einem Doktor Lochner interessante Dinge über die Anstalt und ihre Besucher erfahren. Dr. Lochner, ein älterer und erfahrener Arzt auf dem Gebiete der geistig Kranken machte mir bereitwillig Mitteilung von dem, was ich fragte. Der Eindruck im Äußeren, den die Anstalt schon bei einer früheren Predigt auf mich machte, blieb diesmal derselbe gute, würde aber von selbst kaum eine Erweiterung erfahren haben, da ich als Prediger mit keinem der Kranken in nähere Berührung komme. Was man in dem Hause oder richtiger gesagt in dem Komplex von Häusern, welche die Anstalt bilden, auf den ersten Blick sieht, ist sehr wohltuend u. befriedigend. Man empfindet durch aus nicht das Schablonenmäßige einer Anstalt. Die angenehme Unterbrechung zwischen Haus und Garten, die darin herrschende wohltuende Ruhe müssen sehr günstig auf den nervösen Zustand der oft reizbaren Kranken wirken.
Was mir, beim ersten Male wenigstens, etwas unheimlich verkam, war die Art des Türverschlusses. Alle Schlösser haben nämlich von innen keine Klinke, sondern müssen vermittelst eines Schlüssels geöffnet werden, den jeder Beamte der Anstalt bei sich hat. Das gilt auch von der Kirche, und ich war nicht wenig erstaunt, als ich mich dort plötzlich eingeschlossen fand und absolut kein Mittel sah,
jemand von draußen herbeizurufen. Zum Gottesdienst kommen von den 60 - 70 Kranken, welche augenblicklich da sind, nur etwa 15; nämlich immer nur die gesündesten; es soll indes zuweilen vorkommen, dass einer während des Gottesdienstes wieder hinausgebracht werden muss.
Den Anwesenden merkt man in keiner Weise an, dass sie krank sind, ja auf eine gewisse Entfernung konnte ich nicht einmal die Bedienstenten und Beamten der Anstalt, welche keinerlei Uniform tragen und gleichfalls dem Gottesdienste beiwohnen, von den Patienten unterscheiden. Das bestätigte mir auch Dr. Lochner. Es sei, sagte er, für den Laien sehr oft außerordentlich schwer, nur Spuren geistiger Krankheit bei den Leuten zu entdecken, die doch nicht Herr ihrer selbst und darum im Leben leicht gefährlich wären. Es ist deshalb in der Anstalt Grundsatz, sich nie durch den Schein der Gesundheit, die auch zuweilen dem Erfahrenen als solchen erscheint, betrügen zu lassen. Es wird von den Kranken natürlich auch sehr viel dissimuliert, da sie fast alle kein Bewusstsein von ihrer Krankheit haben und ganz unrechtmäßiger Weise interniert zu sein glauben. Bei Solchen muss dann auch einmal Strenge, resp. Gewalt angewendet werden. Ich fragte, ob der so genannte religiöse Wahnsinn verhältnismäßig oft vorkomme, hörte aber, dass sich rein religiöse fixe Ideen fast niemals fänden, sondern immer nur mit anderen gemischt. Meistens wären die Ideen der Kranken negativer Art, d.h. sie glauben, dies oder jenes verschuldet zu haben, an dem Unglück der Familie Schuld zu sein etc. Das spielt dann, wie natürlich, leicht auf das religiöse Gebiet hinüber. Dagegen sollen religiös krankhafte Zustände sich bei Leuten aus den niederen Ständen, die aus Rücksicht auf die Kosten nicht nach der Privatanstalt Stötteritz, sondern nach Colditz oder Sonnenstein kommen, öfter finden. Das ist wohl so zu erklären, dass die Religion fast die einzige Form im Geistesleben der ungebildeten Stände ist. Auffällig oft findet sich in unseren Tagen eine Art geistiger Gestörtheit, welche von den Ärzten im Allgemeinen Gehirnerweichung genannt wird und jetzt geradezu epidemisch sein soll. Man ist noch nicht ganz klar, wo die Gründe für diese Erscheinung des 19. Jahrhunderts liegen. Man sucht sie sowohl in geistiger Überarbeitung, als auch in der Hyperkultur, in der wir stehen, und die zu große Ansprüche an unsern Organismus macht. Beides vereint wird wohl Schuld daran sein.
Neben Anderem erkundigte ich mich noch nach den Bedingungen für Aufnahme in die Anstalt. Es wird dafür ein ärztliches Zeugnis gefordert, welches die Aufnahme notwendig erscheinen lässt. Darin verlangt die Anstalt, dass Niemand unter falschen Vorwänden hineingelockt wird, da dies die ganze ärztliche Behandlung dann ungemein erschwert. In einzelnem Falle augenscheinlicher Bedürftigkeit wird zwar von der Höhe dieser Summe abgegangen, aber die Regel bleibt dieser Satz.

Regelmäßig, wie ein Uhrpendel, bewegt sich mein Leben. Solche Zeiten sind im Leben recht notwendig, um Sprünge, die man vorher gemacht hat, zum Ausgleich und zu vollkommener Ausbildung zu bringen. Zu meiner Arbeit im Predigerkolleg ist nur noch eine wenig umfangreiche neue getreten. Ich erteile seit zwei Monaten den Missionszöglingen im Missionshause aushilfsweise Unterricht. Lic. Schnedermann bat mich wiederholt darum, und ich nahm es ganz gern an, da ich verlangt hatte wie der Bremer so auch der hiesigen Mission näher zu treten. Leider gefällt mir in der Carolinerstrasse gar nicht Alles. Die Mission ist hier zu wenig populär; und das liegt an den leitenden Persönlichkeiten: Direktor Hardeland ist ein recht liebenswürdiger, aber auch ein ziemlich aristokratisch auftretender Herr; Pastor Hashaben, der theologische Lehrer, hat zwar viel Fertigkeit auch populär zu reden, steht aber leider auf einem so einseitig konfessionellen Standpunkte, dass ihm und Andern jede freiere Regung dabei unmöglich ist. Ich werde trotzdem tun, was in meinen Kräften steht, um dem guten Werke der Mission hier zu helfen; hoffentlich bietet sich mir bald bessere Gelegenheit dazu.
Im Prediger-Kolleg. ist jetzt die Arbeit verhältnismäßig angenehm. Es sind im Ganzen tüchtige Kräfte da. Vogel, ein gutmütiger, aufrichtiger und allezeit freundlicher Bräutigam, ist bereits pastor designatus in Kleinwolmsdorf bei Radeburg; er verlässt uns schon in den nächsten Tage. Etwas länger wird der ebenfalls verlobte Harter bleiben, der es gut meint und an seinen Ort gestellt auch einmal ganz brav arbeiten wird. Von ihm und Vogel habe ich indes bis jetzt wenig Anregung empfangen. Das gilt mehr von dem augenblicklich abwesenden Kollegen Keil, welcher als Sohn des
Alttestamentlers Prof. Keil ein wissenschaftlich gut durchgebildeter Theologe ist: entschieden der Gescheiteste von uns. Um so mehr bedaure ich, dass er einen ziemlich scharfen konfessionellen Standpunkt einnimmt, was mir ein näheres Verhältnis zu ihm unmöglich macht. Übrigens sind wir in Folge gewisser gleichartiger Anlage (Heiterkeit) uns ziemlich sympathisch. Geradezu unsympathisch aber ist mir ein noch junges Mitglied, Kollege Härtig. Er steht noch strenger als Keil, ist der verkörperte Staatskirchenbegriff und ein sehr streitbarer Theologe. Obgleich ich nicht gerne mit ihm disputiere, er kommt mir gerade wie Hesstusias vor, lässt sich doch nicht vermeiden, dass wir bei Reccesionen etc. aneinander geraten. Das wir uns so wenig sympathisch sind, tut mir um desswillen besonders leid, weil Härtig durch enormen Fleiß sehr viele Kenntnisse besitzt und sehr tüchtige homiletische Arbeiten liefert.
Ein ganz vorzüglicher und mir recht angenehmer Mensch ist Drews. Er war Thomasschüler, ich habe ihn aber erst beim Eintritt ins Kolleg. kennen gelernt. Es ist eine ernste und doch sehr milde Natur. Er hat, wie ich, eine Neigung zum Pietismus; ist aber viel mehr als ich fertige Persönlichkeit. Ich weiß noch nicht, soll ich ihn darum beneiden oder mich darüber glücklich schätzen. Ich neige doch sehr zum Ersteren. Der Verkehr mit Drews ist aber jetzt ziemlich beschränkt, da er sich auf das zweite theologische und auf das Doktorexamen vorbereitet.
Außer diesen sind noch Cordes und Merz Mitglieder des Kollegiums. Jener, Sohn der Missionsseniors, ein tüchtiger Mensch, über dessen theologische resp. religiöse Stellung ich aber noch nicht recht im Klaren bin. Ebenso scheint Merz noch sehr im Werden begriffen zu sein. Er kommt eben erst von der Universität. Nächste Woche (10. Aug.) ist Hochzeit des ehemaligen Kollegen Teichgräber.

Heute ist gerade ein Jahr verflossen, seitdem ich wieder die Luft des engern Vaterlandes atme – eine inhaltreiche Zeit für mich, die mir viele ernste Erfahrungen gebracht hat. Es ist eine Reifezeit für mich gewesen; dieselbe war mir vor dem Eintritt ins Amt noch recht notwendig, ebenso wie die Erholung in leiblicher Hinsicht, die ich, Gott sei Dank, auch in Etwas gefunden habe. Zwar fühle ich mich auch heute noch nicht ganz gesund. Magen und Nerven werden bei mir wohl schwerlich wieder so gut werden, dass ich sie nicht alle Tage fühlen müsste. Aber ich freue mich, dass ich diese Quälgeister mit der Zeit habe als einen wohltätigen Dämpfer jugendlichen Übermuts ansehen lernen. Augenblicklich befinde ich mich am Anfang eines neuen Semesters recht wohl und sorglos. Ich habe den September im Elternhause verlebt. Außer leiblicher Erholung war mir da das Zusammensein mit Bruder Fritz und Fürchtegott besonders angenehm. Wir haben ein paar gemütliche Wochen verlebt und alle drei aus dem elterlichen Hause wieder Etwas von den einfachen anspruchslosen Lebensanschauungen mit hinweg genommen, die dort zu Hause sind. Mit mir selbst bin ich allerdings im Rückblick auf diese Zeit im Elternhause gar nicht zufrieden. Wenn ich mit den Eltern zusammen bin, so stellt sich bei mir eine wunderbare, mir selbst unbegreifliche Kälte im gegenseitigen Verkehre ein. So oft ich mir schon vorgenommen habe, sie zu überwinden, es ist mir immer nur auf ganz kurze Zeit gelungen, während ich dagegen, sobald ich das Elternhaus verlassen habe, in allen meinen Gedanken ein sehr zärtliches Verhältnis zu den Eltern pflege. Wie hässlich ist es, dass auch in dieser Beziehung das reine natürlich Gefühl so durch die Reflexion gestört wird. Das ist der Unsegen unserer Zeit.
Der Aufenthalt in Lorenzkirch wird übrigens bedeutungsvolle Folgen für mein weiteres Leben haben, so Gott will. Der alten Liebe heiße Glut drang wieder mir ins Herz hinein. Wer Weiß, was die nächsten Wochen in dieser Beziehung bringen. Ich war übrigens nicht der einzige der Brüder, dessen Blut in Wallung kam. Fürchtegott hat sein Herz an die einsame Toni von Zeithain verloren. Er ging als mutiger Jägersmann sogar recht mutig vor, und will sein Rehlein in Strahlen, wohin Grimms nächstens ziehen, noch endlich erjagen. Bruder Fritz sucht, findet aber zur Zeit noch nicht das "ich weiß nicht was".
In unsern Familienverhältnissen hat sich sonst Nichts von außergewöhnlicher Bedeutung eingestellt. In Skässgen ist zu den drei Jungen, die das Haus sehr lebhaft machen, eine kleine Nichte gekommen. Das ist bei der Regelmäßigkeit der wachsenden Familie aber Nichts Außerordentliches. Wir Geschwister waren zur Taufe dort, die ganz in Familie gefeiert wurde. Marie hat es glücklich überstanden und scheint eine recht zufriedene Mutter zu sein. Sie nimmt ihre Mutteraufgabe ernst und verdient sicherlich die Freude, die sie bisher an ihren Kindern erlebt. Es liegt ein wundersamer Reiz über ihrem heimlichen Kinderschlafgemach, den ich immer wieder empfinde, so oft ich dahin komme. Es beschlicht mich da zuweilen eine Art von Sehnsucht.
|
 1 MB, Seite
5:
1 MB, Seite
5:
![]() 1 MB, Seite
5:
1 MB, Seite
5:
![]()